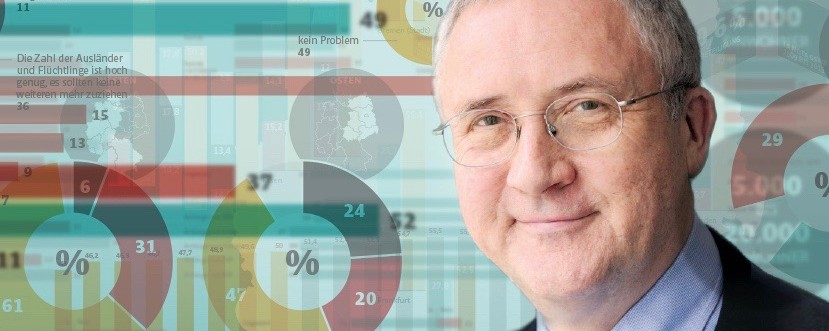Droht das Ende der Kommunalpolitik?
Das Ergebnis der Kommunalwahlen vom 6. Mai in Schleswig-Holstein bestätigt eine schon in den letzten Jahren zu beobachtende Entwicklung zur Wahlabstinenz bei Wahlen vor Ort. Im gesamten Land Schleswig-Holstein gaben wie schon bei der letzten Kommunalwahl vor fünf Jahren nur noch weniger als die Hälfte (46,5 %) eine gültige Stimme ab, während mehr als die Hälfte (53,5 %) nicht zur Wahl ging (bzw. eine ungültige Stimme abgab). Und in einer Stadt wie Flensburg, von der keine außergewöhnlichen Probleme und Schwierigkeiten bekannt sind, war die Zahl der Nichtwähler (einschließlich der ungültigen Stimmen) mit 64,9 Prozent fast doppelt so hoch wie die Zahl der Wähler, die eine gültige Stimme abgaben (35,1 %).
Kommunalpolitik verliert in ganz Deutschland an Relevanz
Dieser rapide Anstieg der Zahl der Nichtwähler bei lokalen Wahlen, der ja nicht nur in Schleswig-Holstein, sondern flächendeckend in der gesamten Republik zu beobachten ist, kann nicht auf einen generellen Trend zu größerer Wahlenthaltung auf allen Ebenen der Politik zurückgeführt werden. Zwar ist auch bei Bundestagswahlen seit Anfang der 1980er Jahre ein Rückgang der Wahlbeteiligung zu registrieren, aber dieser Rückgang war, im Vergleich zu dem Wählerschwund auf lokaler Ebene, deutlich geringer. Bemerkenswert ist zudem, dass bis zu Beginn der 1990er Jahre die Wahlbeteiligung bei Kommunalwahlen zwar nie so hoch wie bei Bundestagswahlen, doch mit Anteilen zwischen 70 und 80 Prozent um ein Vielfaches höher war als heute. Wie in Schleswig-Holstein hat sich auch in allen anderen Bundesländern die Differenz zwischen der Wahlbeteiligung bei Bundestags- und der bei Kommunalwahlen seit Anfang der 1990er Jahre kontinuierlich vergrößert. Die extrem geringe Beteiligung bei kommunalen Wahlen kann auch nicht, wie häufig so auch am Wahlabend in Schleswig-Holstein von politischen Akteuren als Begründung für das schwache Wählervotum vor Ort angeführt, auf einen aktuellen Unmut der Bürger über die Politik in Berlin zurückgeführt werden. Selbst wenn es einen solchen großen Unmut über die Berliner Politik tatsächlich gäbe – was sich aus den kontinuierlichen politischen Stimmungsmessungen jedoch nicht herleiten lässt -, wäre damit nicht erklärt, warum schon bei der Kommunalwahl 2013 in Schleswig-Holstein ebenso viele Wahlberechtigte nicht zur Wahl gingen wie 2017 und warum sich bei der Oberbürgermeister-Direkt-Wahl 2016 in Flensburg gar fast 70 Prozent nicht an der Wahl beteiligten. Die unterschiedliche Höhe der Wahlbeteiligung bei kommunalen Wahlen – ob zu den Vertretungen auf Gemeinde- oder Kreisebene oder der Direktwahl der Bürgermeister und den Landtags- bzw. Bundestagswahlen sowie die unterschiedlichen Mobilisierungsquoten der Parteien bei den verschiedenen Wahlen sind ein deutlicher Beleg dafür, dass die Bürger genau zwischen den einzelnen Politikebenen unterscheiden können und die Wahlentscheidung bei lokalen Wahlen keinesfalls ein bloßer Reflex der politischen Großwetterlage ist. So dürfte die Tatsache, dass die „Merkel-CDU“ im September 2017 bei der Bundestagswahl in Schleswig-Holstein von über 580.000 Wählern gewählt wurde, die örtliche CDU in den Gemeinden und Städten Schleswig-Holsteins jedoch sieben Monate nach der Bundestagswahl nur von knapp 390.000, wohl nicht auf einen Unmut über die CDU auf Bundesebene, sondern in erster Linie auf das Urteil über den jeweiligen Zustand der CDU vor Ort zurückzuführen sein. Und wäre der Unmut über die Politik in Berlin wirklich so groß, wie von manchen politischen Akteuren unterstellt, hätte die AfD als vorgebliche „Protestpartei“ bei der Kommunalwahl ähnlich viele Stimmen – 140.000 – wie im Herbst letzten Jahres erhalten müssen. Doch die AfD wurde bei der Kommunalwahl nur noch von rund 61.000 Wählern (das entspricht ganzen 2,6 Prozent aller Wahlberechtigten) gewählt. Der Stimmenanteil der AfD ist also in den letzten 7 Monaten um fast 60 Prozent geschrumpft.
Wahlbeteiligung spiegelt nicht Desinteresse an Politik
Der rapide Rückgang der Wahlbeteiligung bei lokalen Wahlen ist auch nicht darauf zurückzuführen, dass sich die Bürger nicht mehr für das politische Geschehen in ihrer Gemeinde oder Stadt interessieren; denn wie eine aktuelle forsa-Untersuchung im April dieses Jahres zeigen konnte, interessiert sich nach wie vor die große Mehrheit der Bundesbürger (62 %) stark oder sogar sehr stark für die Politik in ihrem Wohnort. Bemerkenswerterweise ist das Interesse am politischen Geschehen in der Wohngemeinde in allen Bildungsschichten und im ländlichen Raum wie in den urbanen Metropolen gleich hoch. Lediglich bei den jüngeren Bürgern ist das Interesse weniger ausgeprägt als bei den älteren, über 60-jährigen Bürgern. Ein weiterer Beleg dafür, dass die geringe Wahlbeteiligung nicht auf ein großes Ausmaß von Desinteresse an der lokalen Politik zurückzuführen ist, ist auch der weitere Befund der aktuellen forsa-Untersuchung, dass nämlich fast die Hälfte aller Bundesbürger weiß, wann die nächste Wahl der Gemeinde- bzw. Stadtverwaltung stattfindet. Der Grund für die schrumpfende Wählerzahl bei Kommunalwahlen ist in der Kommunalpolitik selbst zu suchen – was die Bürger im Übrigen ähnlich sehen. Die meisten der von forsa Befragten vermuten als Grund für die hohe Zahl von Nichtwählern bei kommunalen Wahlen, dass sich die Kommunalpolitiker nicht mehr um die wirklichen Probleme und Sorgen der Bürger vor Ort kümmern. In die gleiche Richtung geht die geäußerte Einschätzung, dass die Kandidaten, die bei kommunalen Wahlen antreten, nicht bekannt und profiliert genug seien bzw. nicht in ausreichendem Maße überzeugend seien. Weiterhin geben die Befragten den häufig als zu heftig empfundenen Streit zwischen den örtlichen Parteien als Grund für die hohe Wahlenthaltung an. Immer mehr Bürger beteiligen sich nicht mehr an lokalen Wahlen, weil die von vielen Akteuren auf kommunalen Ebenen betriebene Politik ihren Erwartungen an eben diese kommunale Politikebene nicht mehr entspricht und oft auch die Qualität des von den Parteien vor Ort angebotenen Personals für nicht mehr ausreichend eingeschätzt wird.
Unmut ist auch von Verantwortlichen mitgeschürt
Das Empfinden, dass in vielen Rathäusern nicht mehr die von den Bürgern erwartete pragmatisch-rationale und eher auf Konsens orientierte, sondern ein Abklatsch der „großen“ Politik mit ideologischen Scheuklappen betrieben wird, wurde ja auch in Schleswig-Holstein kurz vor der Kommunalwahl durch die Flensburger Oberbürgermeisterin nachdrücklich bestätigt. Simone Lange, die 2016 trotz Unterstützung von SPD, Grünen und CDU nur von 16 von 100 wahlberechtigten Flensburgern, von 84 aber nicht zur Oberbürgermeisterin gewählt wurde (15 von 100 Wahlberechtigten wählten 2016 einen anderen Kandidaten, 69 überhaupt nicht), zeigte mit ihrer Kandidatur für das Amt der SPD-Parteivorsitzenden, dass ihr Interesse an „großer“ Politik offenbar schon nach einjähriger Amtszeit größer ist als daran, durch solide Kommunalpolitik ihre geringe Vertrauensbasis zu vergrößern. Die Folgen bekam dann „ihre“ Partei, die SPD, bei der Kommunalwahl im Mai dieses Jahres zu spüren, als nur noch 6 von 100 Wahlberechtigten der Flensburger SPD ihre Stimme gaben. Dass auch die CDU nur noch von 7 von 100 Wahlberechtigten Flensburgern gewählt wurde, kann kein Trost für die SPD in der Stadt an der Flensburger Förde sein. Der Ausgang der Kommunalwahl in Schleswig-Holstein ist ein weiteres Warnsignal vor dem drohenden Ende der Kommunalpolitik. Noch kann die Politik ein endgültiges Ende der Kommunalpolitik abwenden, wenn die Erwartungen der Bürger an die lokale Politikebene wieder erfüllt werden. Eine Chance hat die Kommunalpolitik dann noch, wenn z.B. nicht immer wieder trotz aller negativen Erfahrungen über gebietliche Neuordnungen nachgedacht wird, keine weiteren Experimente mit dem Wahlsystem vor Ort betrieben werden oder nicht mehr wie in vielen Bundesländern im nächsten Jahr kommunale Wahlen mit der Europawahl gekoppelt werden, weil dies beide Wahlen eher ab- als aufwertet.