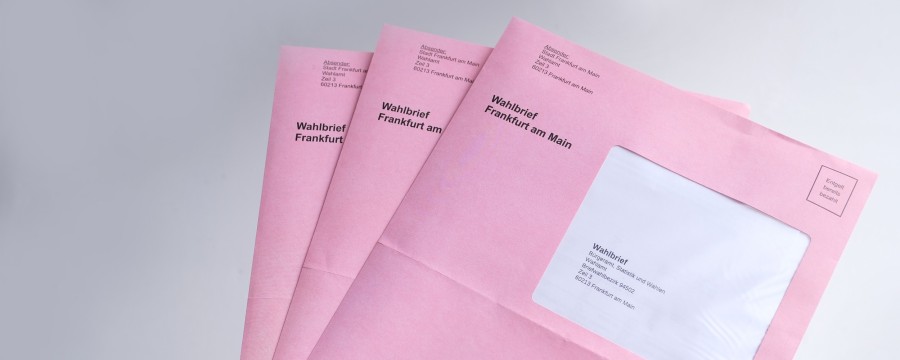Neue Studie
Flüchtlingsunterbringung: Wo Kommunen durchatmen – und wo der Druck bleibt
In der 20.000-Einwohner-Stadt Telgte in Nordrhein-Westfalen konnte im Sommer die monatelang belegte Sporthalle wieder für Schulen und Vereine freigegeben werden. „Mit dem deutlichen Rückgang der Zuweisung Geflüchteter ist eine Entspannung eingetreten“, sagt Annika Becker von der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Stadt. Auch der niedersächsische Landkreis Cuxhaven und der hessische Vogelsbergkreis melden: Die Lage bei der Unterbringung von Flüchtlingen hat sich entspannt.
Zugleich beobachten viele Kommunen, dass wieder mehr Ukrainerinnen und Ukrainer nach Deutschland kommen – ein Trend, der vor allem unterquotale Bundesländer betrifft - Bundesländer, die bisher unterdurchschnittlich viele Flüchtlinge aufgenommen haben.
Ukraine-Flüchtlinge in ostdeutschen Bundesländern
Unter anderem Sachsen-Anhalt steht hier stärker unter Druck. Der Altmarkkreis Salzwedel berichtet: Weil Länder wie NRW oder Niedersachsen in den Vorjahren mehr Flüchtlinge aufgenommen haben, dürfen sie neue Zuweisungen nun an unterquotale Länder wie Sachsen-Anhalt und weitere ostdeutsche Bundesländer weiterleiten.
Leere Unterkünfte, offene Fragen: Wie Kommunen mit freiem Wohnraum umgehen
Für andere Kommunen fragt sich nun: Was tun mit leerstehenden Flüchtlingsunterkünften? Viele Kommunen möchten Kapazitäten vorhalten – denn die Zahl der Flüchtlinge kann sich schnell wieder erhöhen. Dann möchten Kommunen ebenso schnell reagieren können. Doch diese Vorsorge kostet Geld und wird von Bund und Ländern nicht finanziell unterstützt.
In Telgte sind aktuell 90 Plätze ungenutzt. Die Stadt prüft jedoch, ob es weiterhin notwendig ist, diese Plätze vorzuhalten oder ob ein Containerstandort rückgebaut werden sollte. In der saarländischen 18.000-Einwohner-Stadt Püttlingen wird über eine Stand-by-Wohnung diskutiert. Doch die Möglichkeit sei „haushaltsabhängig“, sagt Rebecca Polizzi vom Fachbereich Personal, Organisation und Öffentlichkeitsarbeit.
Wohnungsnot blockiert Integration und belastet Erstunterkünfte
Trotz des Rückgangs an Zuweisungen bleibt die Anschlussunterbringung schwierig. Denn der Wohnungsmarkt ist auch 2025 in den meisten Kommunen stark angespannt. Viele Kommunen berichten von „Fehlbelegern“ – Menschen, die Anspruch auf eigenen Wohnraum haben, aber mangels des Angebots in Sammelunterkünften verbleiben. Die Folgen: Integrationsprozesse stocken, Plätze für neue Flüchtlinge fehlen.
In Püttlingen ist man noch immer mit der Anschlussunterbringung von Flüchtlingen beschäftigt, die der Stadt im Zeitraum 2022 bis 2023 zugewiesen wurden. Klaus Janczyk von der Pressestelle der Stadt Moers in NRW berichtet, dass „rund 60 Prozent der untergebrachten Personen Fehlbeleger“ seien. Auch in der 16.000-Einwohner-Stadt Altdorf bei Nürnberg und der baden-württembergischen 34.000-Einwohner-Stadt Kornwestheim fehlen bezahlbare Wohnungen.
Integration Geflüchteter: Kommunen wollen, aber werden gebremst
Weniger Neuankömmlinge geben Kommunen mehr Zeit für die Integration der Menschen vor Ort. Sandra Schuon, Pressesprecherin von Kornwestheim sagt, die Entlastung schaffe „mehr Spielraum, um sich gezielter auf die Menschen zu konzentrieren, die bereits hier leben.“ Die geringeren Zugänge sorgten besonders für Entlastung bei den Ehrenamtlichen. „Ohne diese Menschen gäbe es nur sehr wenige Integrationsmaßnahmen vor Ort“, sagt Christof Rothkegel, Geschäftsleiter der Stadt Altdorf.
Trotzdem bleibt auch die Integration vielerorts mühsam. „Viele Geflüchtete bekommen keine Arbeitserlaubnis und dürfen nicht an Sprachkursen teilnehmen. Integration ist so oft unmöglich“, sagt Annika Becker von der Stadt Telgte. Auch Kornwestheim und Püttlingen beschreiben, dass geflüchtete Menschen weiterhin mit Bürokratie, fehlenden Sprachkursen, wenig psychosozialer Unterstützung oder mangelhaften Wohnalternativen zu kämpfen haben. Heiko Abbas, Bürgermeister der 15.000-Einwohner-Stadt Weener (Ems) in Niedersachsen, bringt es kurz und knapp auf den Punkt:
Die Probleme bestehen aktuell eher in der Integration der bereits hier lebenden Geflüchteten.
Ausländerbehörden im Ausnahmezustand: Personalnot, hohe Fluktuation, Dauerstress
Die Umfrage der Universität Hildesheim belegt: 45 Prozent der Ausländerbehörden in Deutschland arbeiten im Notfallmodus. Die Rückmeldungen an KOMMUNAL bestätigen das Bild. Cuxhaven beschreibt den Bereich als „krisengeschüttelt“, der Vogelsbergkreis sieht seine Behörde „am Limit“.
Moers ist aktuell gut aufgestellt, doch Klaus Janczyk gibt zu bedenken: „Die Neugewinnung und langfristige Bindung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist aktuell die größte Herausforderung. Auch steigende Fallzahlen und die schnelllebige Rechtsprechung, insbesondere in Phasen von Arbeitsspitzen, stellen die Ausländerbehörde immer wieder vor neuen Aufgaben.“ Die Folge: Asylverfahren verzögern sich, Entscheidungen über Arbeitserlaubnisse und Familiennachzug bleiben liegen.
Kommunale Flüchtlingsfinanzierung: Pauschalen reichen nicht, Bürokratie bremst
Eine zentrale Erkenntnis der Befragung: Die kommunalen Flüchtlingskosten 2025 werden von Bund und Ländern nicht auskömmlich gegenfinanziert. In Telgte übersteigen Wohn- und Instandhaltungskosten die Pauschale deutlich. „Aktuell werden für Asylbewerberinnen und Asylbewerber, die noch im Verfahren sind, Leistungen erstattet“, erklärt Annika Becker. „Es werden jedoch in einer Vielzahl von Fällen wegen des Asylstatus – abgelehnte Asylbewerber mit Duldung – Personen keine Pauschalen gewährt. Diese Personen leben aber häufig noch über Jahre in den Kommunen und erhalten sowohl Sach- als auch Geldleistungen und medizinische Versorgung.“
Der Vogelsbergkreis nennt nicht gedeckte Posten wie soziale Betreuung, Verwaltung, Sicherheitsdienste und Leerstandskosten. Püttlingen fordert bessere und frühere Finanzierung, Cuxhaven kritisiert die verzögerte Auszahlung. Viele Kommunen berichten von übermäßig bürokratischen Hürden beim Abruf von Mitteln.
Was Kommunen jetzt fordern
Die Forderungen der Kommunen an Bund und Länder sind deutlich:
- Weniger Regulierungen, mehr kommunaler Handlungsspielraum
- Schnellere Asylverfahren
- Verbesserte Abstimmung bei Zuweisungen
- Digitalisierung zur Entlastung der Behörden
- Finanzierung von Sprachkursen, Betreuung und Wohnraum
Ein zentraler Wunsch: Flüchtlinge sollen schneller arbeiten dürfen. „Viele Geflüchtete würden gerne arbeiten und dürfen nicht“, sagt Christof Rothkegel aus Altdorf. Kornwestheim kritisiert hohe Hürden für den Arbeitsmarktzugang.
Auch weitere Unterstützung bezüglich der Unterbringung wird benötigt: Der Landkreis Nürnberger Land fordert strategische Unterbringungsreserven auf Landes- oder Bundesebene, um die kommunale Überlastung bei steigenden Flüchtlingszahlen zu verhindern.
Durch eine verlässliche Finanzierung könnten nachhaltige Strukturen für Unterbringung und Integration geschaffen werden. „Ein Nutzen für alle am Integrationsprozess Beteiligten“, sagt Rebecca Polizzi aus Püttlingen.

Strukturelle Defizite bleiben – Wohnungsnot, Bürokratie, Finanzierung
2025 erleben viele Kommunen eine Entspannung bei der Flüchtlingsunterbringung. Doch darunter bleibt die Lage angespannt. Der Wohnungsmarkt ist überlastet, Integration leidet unter Bürokratie und Unterfinanzierung und Ausländerbehörden arbeiten am Limit. Die finanzielle Unterstützung durch Bund und Länder ist vielerorts unzureichend.