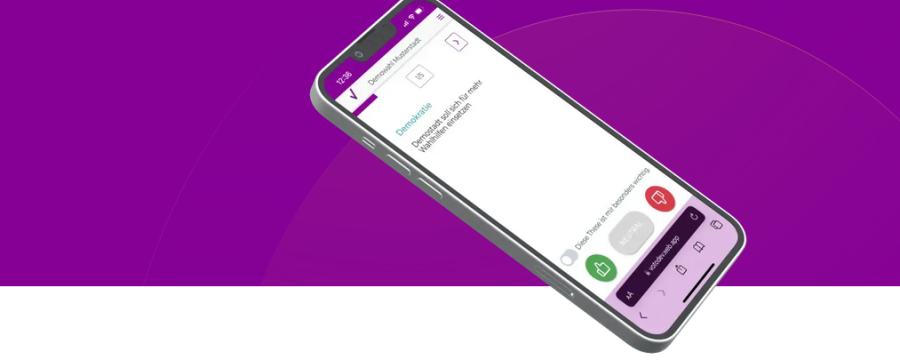Reform
Grundsteuer: Sollen Kleingärten befreit werden?
Neue Berechnungen nach der Grundsteuerreform führt in elf Bundesländern zu deutlich höheren Grundsteuerwerten – und damit zu spürbaren Mehrbelastungen. Auch der Bundesfinanzhof befasst sich derzeit mit drei Musterklagen zum Bundesmodell. Es geht darum, ob das typisierte Bewertungsverfahren mit dem allgemeinen Gleichheitsgrundsatz vereinbar ist. Am 10. Dezember will der BFH seine Entscheidung dazu bekannt geben.
Grundsteuerbescheide für Wochenendgrundstücke gestiegen
Nicht nur die Besitzer von Wohngrundstücken, sondern auch die Eigentümer von Wochenendgrundstücken sowie größerer Kleingärten, die nicht unter das Bundeskleingartengesetz fallen, beklagen steigende Grundsteuerbescheide. Die höhere Belastung bekommen auch tausende von Pächtern finanziell zu spüren. Denn die Eigentümer können die Kosten auf sie umlegen.
„Eigentümer und Pächter von Wochenendgrundstücken sind teilweise massiv von der neuen Grundsteuer betroffen“, resümiert Frank Hufnagel, Sprecher des Verbands Deutscher Grundstücksnutzer (VDGN) knapp ein Jahr seit Inkrafttreten der Grundstücksreform. Der Verband mit rund 400 angeschlossenen Vereinen und mehr als 100.000 Mitgliedern beobachtet bundesweit starke Anstiege der Steuerbelastung.
Wochenendhaus auf einem Wohngrundstück?
Ein wesentlicher Grund: Wochenendhäuser gelten bei der Grundsteuer als Wohngrundstücke – unabhängig davon, dass sie baurechtlich oft anders eingestuft sind. Für sie werden deshalb die höheren Bodenrichtwerte für bebaute Grundstücke angesetzt. Häufig steige die jährliche Belastung um das Zehnfache auf über 1000 Euro, so Hufnagel. Besonders in Berlin mache sich dies bemerkbar, wo die Bodenrichtwerte hoch und die Steuermesszahl für Nicht-Wohngrundstücke auf 0,45 Promille angehoben wurde.
Der VDGN fordert daher, Wochenendgrundstücke bei der Grundsteuerbewertung bundesweit einheitlich als Freizeit- und Erholungsgrundstücke einzustufen und dafür einen deutlich niedrigeren Bodenrichtwert anzusetzen. In Berlin würde dann ein Bodenrichtwert von 80 Euro pro Quadratmeter gelten, so wie es der Gutachterausschuss mit Stichtag 1. Januar 2022 für Freizeitgrundstücke festgelegt hat. Nach Ansicht des Verbands könnte Berlin dies per Verordnung anstoßen oder eine Bundesratsinitiative einbringen, um diese Sondergebiete für Erholung bei den sonstigen Flächen und nicht mehr unter Bauland einzuordnen.
Wann lohnt es sich, einen Bescheid anzufechten?
Für Eigentümer solcher Grundstücke und auch von Wohngrundstücken, die ihren Bescheid anfechten möchten, gebe es laut Hufnagel nur eine Möglichkeit: Sie müssten über ein Gutachten für den Stichtag 1. Januar 2022 nachweisen, dass der tatsächliche Wert mindestens 40 Prozent unter dem angesetzten Grundstückswert liegt.
Anders stellt sich die Situation bei klassischen Kleingärten dar. Sie werden grundsätzlich dem land- und forstwirtschaftlichen Vermögen (Grundsteuer A) zugeordnet, was die Belastung gering hält. In Berlin zahlen Kleingärtner derzeit gar keine Grundsteuer: Der Senat hat für diese Flächen den Hebesatz auf null festgelegt. „Hier geht es meist um eher geringere Beträge“, sagt Hufnagel.
Antrag: Kleingärten von der Grundsteuer befreien
In Brandenburg sorgte zuletzt ein Vorstoß der CDU-Landtagsfraktion für Aufmerksamkeit: Sie wollte Kleingärtner vollständig von der Grundsteuer befreien. Die rund 60.000 Kleingärten in etwa 12.000 Vereinen im Land dienten dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und die "kleine Scholle Freiheit" sollte nicht zum Luxusgut werden. Ein Gutachten des Parlamentarischen Beratungsdienstes bestätigte, dass das Land eine solche Befreiung rechtlich regeln könnte.
Der Landtag sollte die Landesregierung dazu auffordern, einen Gesetzesentwurf für ein entsprechendes brandenburgisches Grundsteuergesetz zu erarbeiten. Kleingartenland einschließlich der Lauben sollten nicht als steuerpflichtiger Grundbesitz gehalten. Es sollte sichergestellt werden, dass die Gemeinden keine Grundsteuer A und B auf Kleingärten erheben und zugleich die kommunalen Hebesätze unberührt lassen. Neben der Entlastung der Kleingärtner wäre auch der Verwaltungsaufwand für die Datenerhebung tausender Parzellen entfallen. Der Antrag scheiterte jedoch im Landtag. Unbeantwortet blieb auch die Frage, ob das Land die Kommunen für die Einnahmeausfälle entschädigen würde.
Weitere Informationen für Kleingärtner und Datschenbesitzer liefert eine Broschüre des Finanzministeriums Brandenburgs.