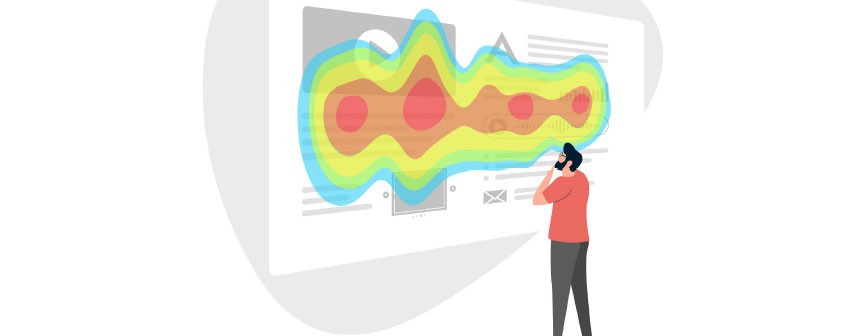
Leitartikel
Wärmewende 2025: Wenn Pläne statt Wärme produziert werden
Es ist ja nicht so, dass wir Deutschen keine Pläne hätten. Im Gegenteil: Wir haben Wärmekarten, Heizlastberechnungen, Farbskalen für Sanierungsgebiete und eine kommunale Wärmeplanungspflicht, die klingt wie die Bedienungsanleitung für ein Raumschiff.
Nur leider wärmt das alles weder ein Mehrfamilienhaus in Bitterfeld noch ein Reihenhaus in Hallenberg. Und vielleicht ist es genau deshalb so still geworden um das Mega-Thema Wärmeplanung. Viele Bürgermeister hatten wohl gehofft, die neue Regierung würde Zeitpläne und Richtlinien aufweichen. Doch auch diexxx Ampel-Nachfolgerin traut sich nicht, das Fass erneut aufzumachen.
Bürgermeister als Heizungsplaner
Und so stapeln sich in den Rathäusern die Aktenordner. Bürgermeister, die noch gestern ihre Grundschule vor Schimmel retten oder die Dorfstraße asphaltieren wollten, müssen heute Wärmestrategien entwickeln – ohne Daten, ohne Handwerker, ohne Geld.
Was bleibt, ist ein Auftrag, der klingt wie eine Mischung aus Greenpeace-Papier und Bundesanzeiger: „Die Kommune hat eine Wärmeplanung vorzulegen.“ Punkt. Keine Frage, nur ein weiteres „muss“.
Das Ikea-Regal der Politik
Die Wärmewende ist wie das Ikea-Regal der Politik: In der Werbung sieht alles kinderleicht aus. In der Praxis fehlen Schrauben, die Anleitung ist unverständlich, und am Ende bleibt man mit einem schiefen Konstrukt zurück.
Der Bund erklärt den Kommunen zwar, wie wichtig Klimaneutralität bis 2045 ist, liefert aber weder Werkzeug noch Material. Stattdessen verordnet er eine Pflicht, die klingt, als hätte ein Jurist im Energieministerium eine Wette verloren: Wer schreibt die komplizierteste Vorgabe?
Galgenhumor in den Rathäusern
Und wie reagieren die Kommunen? Mit Galgenhumor. Ein Bürgermeister erzählte mir kürzlich: „Wir planen gerade eine Nahwärmeversorgung – die Unterlagen sind so dick, dass wir das Rathaus heizen könnten, wenn wir sie im Winter verbrennen.“
Zynisch? Ja. Realistisch? Noch mehr!
Praxis statt PowerPoint
Das Paradoxe: Kommunen wissen längst, wie es geht. Viele haben Nahwärmegenossenschaften gegründet, Biogasprojekte angeschoben oder betreiben Holzheizungen. Aber während die Praxis funktioniert, zwingt Berlin sie nun, Realität in Tabellen zu pressen.
Das Ergebnis: Mehr Wärmekarten als Wärmepumpen. Deutschland, das Land der Paragrafenreiter, beheizt ganze Büros mit PowerPoint-Präsentationen. Doch zwischen Papier und Praxis fehlt der Monteur, der die Wärmepumpe tatsächlich einbaut.
Akzeptanz in Gefahr
Noch gefährlicher: Die Akzeptanz in der Bevölkerung schwindet. Wer sein Einfamilienhaus umrüsten will, stößt auf Vorschriften, Genehmigungen und Förderbedingungen, die klingen wie ein Kafka-Roman.
Am Ende bleibt das Gefühl: Wärmewende ist kein Fortschritt, sondern Zwang. Und was Zwang erzeugt, kippt schnell in Widerstand. Ohne die Bürger geht es aber nicht – sie müssen die Heizungen einbauen, die Nahwärmeanschlüsse akzeptieren, die Kosten tragen.
Wenn sie jedoch den Eindruck haben, dass ihnen Politik ein unerfüllbares Versprechen als Pflicht verkauft, bleibt die Wärmewende das, was sie schon jetzt ist: eine Verwaltungsvorschrift ohne Herzschlag.
Die Allzweck-Ausrede aus Berlin
Natürlich wird man in Berlin wieder sagen: „Die Kommunen schaffen das schon.“ Ein Satz, der offenbar für alles herhalten muss – ob Flüchtlingspolitik, Digitalisierung oder Wärmewende. Am Ende ist es immer der Bürgermeister, der im Feuer steht.
Chancen durch Allianzen
Doch Bürgermeister sind nicht machtlos. Wer jetzt klug handelt, setzt auf regionale Allianzen: Stadtwerke, Handwerksbetriebe und Bürgerenergiegenossenschaften an einen Tisch holen, Förderprogramme bündeln, eigene Wärmenetze anschieben.
Transparente Bürgerforen schaffen Akzeptanz, kleine Pilotprojekte zeigen schnelle Erfolge. Kurz: weniger warten, mehr selbst machen – und das Heft des Handelns nicht aus der Hand geben.
Wärmewende mit den Bürgern
Vor allem gilt: Die Wärmewende kann nur gelingen, wenn sie mit den Menschen statt gegen sie gestaltet wird.
Dafür braucht es keine dicken Leitfäden, sondern echte Beteiligung: Bürgerwerkstätten, Energie-Checks vor Ort, Informationsabende in Sporthallen. Dort entscheidet sich, ob Akzeptanz wächst oder Widerstand.
Wer die Menschen früh einbindet, gewinnt Vertrauen und spart Zeit und Geld. Wärmewende heißt nicht, Bürger mit Vorschriften zuzudecken, bis sie freiwillig schwitzen. Wärmewende heißt, pragmatische Lösungen vor Ort zuzulassen.
Was jetzt gebraucht wird
Was wir brauchen, ist nicht noch ein „Leitfaden zur Wärmeplanung“, sondern Geld, Fachkräfte und Vertrauen.
Wenn die Wärmewende gelingen soll, dann nicht als Beschäftigungstherapie für Rathäuser. Sondern als kommunales Projekt, das die Menschen mitnimmt. Sonst bleibt sie ein weiteres Kapitel im dicken Buch der deutschen Zettelwirtschaft – und der Einzige, der sich daran wärmt, ist der Papierkorb.





