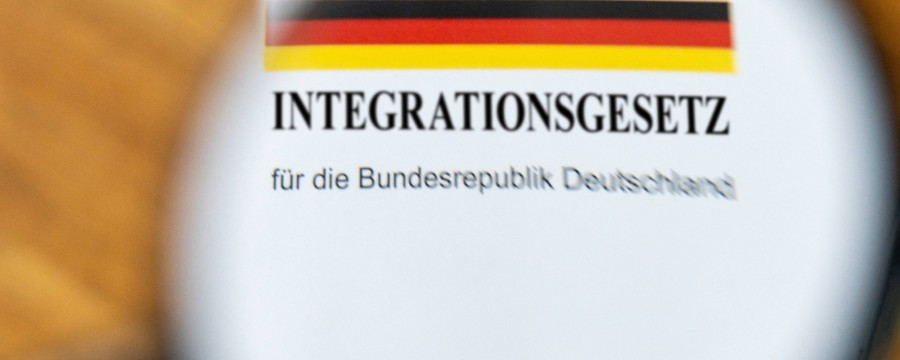
Beschluss im Kreistag
Erstmals in Westdeutschland: Arbeitspflicht für Flüchtlinge
In Peine hat sich die Mehrheit des Kreistags für eine Arbeitspflicht für Flüchtlinge ausgesprochen. Damit steht der Auftrag für die Verwaltung, zu prüfen, welche Tätigkeiten möglich sind - etwa bei der Tafel, im Tierheim oder bei der Grünpflege. Wichtig dabei: Die Tätigkeiten dürfen keine regulären Stellen verdrängen. Damit ist Peine der jüngste Vorstoß in einer Debatte, die derzeit deutschlandweit Fahrt aufnimmt.
„Wir wollen die Menschen beschäftigen, ihnen eine Tagesstruktur geben und zugleich ein Zeichen setzen, dass auch von den Asylbewerbern ein Beitrag zur Gemeinschaft erwartet wird“, heißt es aus dem Kreistag.
Thüringen als Vorbild – Greiz und Saale-Orla mit Erfahrung
Den Anfang machte Thüringen. Dort hatte Landrat Christian Herrgott im Saale-Orla-Kreis schon Anfang 2024 eine Arbeitspflicht eingeführt. Kurz darauf folgte der Landkreis Greiz.
Landrat Ulli Schäfer zieht nach einem Jahr Bilanz: „Von rund 200 Asylbewerbern, die wir eingesetzt haben, sind 64 inzwischen in feste Arbeitsverhältnisse übergegangen.“ Die Beschäftigten arbeiten in Bauhöfen, in Tafeln oder bei Landschaftspflegearbeiten. Die Entschädigung liegt bei 80 Cent pro Stunde – zusätzlich zu den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.
Die Umsetzung erfolgt in enger Abstimmung zwischen Ausländerbehörde, Jobcenter und Bauhof. Wichtig war den Thüringern von Beginn an: Freiwilligkeit, wo möglich – klare Pflichten, wo nötig.
Zwischen Alltagshilfe und Verwaltungsaufwand
Aus kommunaler Sicht ist der praktische Nutzen nicht zu unterschätzen: Viele Bürgermeister berichten, dass sich öffentliche Einrichtungen über zusätzliche Hände freuen – sei es beim Müllsammeln, bei der Pflege öffentlicher Anlagen oder bei Hilfstätigkeiten in Altenheimen.
Bürgermeisterin Katja Stoppe aus Zeulenroda-Triebes sagt: „Die Maßnahme hilft nicht nur den Gemeinden, sondern gibt den Menschen das Gefühl, gebraucht zu werden.“
Doch der Verwaltungsaufwand ist erheblich. Jeder Einsatz muss einzeln geprüft, zugewiesen, kontrolliert und dokumentiert werden. Haftungsfragen und Versicherungen sind zu klären, Arbeitsmittel bereitzustellen. Einige Kreise wie der Burgenlandkreis oder der Harz-Kreis berichten von anfänglichen Startproblemen – und steigenden Personalkosten.
Landrat Götz Ulrich aus dem Burgenlandkreis sagt: „Der Aufwand ist nicht gering, aber er lohnt sich. Wir verhindern Stillstand in den Unterkünften und fördern Integration durch Aktivität.“
Warum der Westen zögert
In westdeutschen Kommunen überwiegt bislang die Zurückhaltung. Viele Kreise prüfen rechtliche Risiken und personelle Ressourcen. Auch der Niedersächsische Landkreistag weist darauf hin, dass eine Arbeitspflicht „nur mit ausreichender Verwaltungskraft“ durchsetzbar sei.
Ein weiteres Problem: Die rechtliche Lage bleibt unsicher. In Greiz wurde die Pflicht zwar in erster Instanz vom Sozialgericht Altenburg bestätigt, das Verfahren liegt aber nun beim Landessozialgericht. Sollten höhere Instanzen den Zwang zur Arbeit kippen, könnte das Modell bundesweit ins Wanken geraten.
Trotzdem signalisiert der Beschluss aus Peine eine neue Richtung. Der Kreis sendet das Signal: Wenn die rechtlichen Spielräume bestehen, nutzen wir sie.
Rechtlicher Rahmen – was Kommunen dürfen
Die Grundlage bildet § 5 des Asylbewerberleistungsgesetzes. Er erlaubt gemeinnützige Tätigkeiten zur Aufrechterhaltung der Unterkunft oder im öffentlichen Interesse – etwa bei Gemeinden oder Wohlfahrtsverbänden.
Zentrale Punkte:
-
Die Arbeitspflicht gilt nur für Personen, die Leistungen nach dem AsylbLG beziehen.
-
Die Entschädigung (meist 80 Cent/Stunde) ist kein Lohn, sondern eine Aufwandsentschädigung.
-
Reguläre Arbeitsplätze dürfen nicht verdrängt werden.
-
Arbeitsunfähige, Schwangere oder Personen mit Betreuungspflichten sind ausgenommen.
-
Bei Verweigerung kann die Leistung gekürzt werden – allerdings nur in engen Grenzen.
Die juristischen Grenzen verlaufen dort, wo die Maßnahme in Richtung Zwangsarbeit oder Grundrechtsverletzung tendiert. Die Kommunen müssen nachweisen, dass es sich um zumutbare, gemeinnützige und verhältnismäßige Tätigkeiten handelt.
Pro und Contra aus kommunaler Sicht
Dafür sprechen
-
Integration durch Beschäftigung: Regelmäßige Arbeit erleichtert Sprache und soziale Kontakte.
-
Signalwirkung: Die Maßnahme zeigt, dass Leistungsbezug und gesellschaftliche Teilhabe zusammengehören.
-
Kommunaler Mehrwert: Bauhöfe und soziale Einrichtungen erhalten Unterstützung.
-
Motivation zur Eigenständigkeit: In Thüringen fanden zahlreiche Teilnehmer anschließend reguläre Jobs.
Dagegen spricht
-
Bürokratischer Aufwand: Verwaltung, Kontrolle, Versicherung und Abrechnung binden Personal.
-
Rechtliche Unsicherheit: Gerichtsurteile könnten Projekte ausbremsen.
-
Symbolpolitik-Vorwurf: Kritiker halten die Wirkung für begrenzt und warnen vor falschen Erwartungen.
-
Gefahr der Stigmatisierung: Wenn Pflichtarbeit als Bestrafung wahrgenommen wird, leidet die Akzeptanz.
Blick in die Praxis
Einige Kommunen in Sachsen-Anhalt und Brandenburg planen, dem Beispiel zu folgen. Andere setzen auf freiwillige Arbeitsgelegenheiten. Ein Trend zeichnet sich ab: Kommunen wollen gestalten – nicht warten, bis das Land entscheidet.
„Wir stehen als Verwaltung an der Front. Wenn sich die Zahl der Leistungsbezieher erhöht, brauchen wir Instrumente, um Aktivität zu fördern“, sagt etwa ein Bürgermeister aus Niedersachsen, der aber nicht namentlich genannt werden möchte.
Gleichzeitig wird deutlich: Eine echte Arbeitspflicht kann nur dann funktionieren, wenn Bund und Länder klare rechtliche Rahmen schaffen und Verwaltungsverfahren vereinfachen.
Fazit
Der Beschluss in Peine könnte zum Wendepunkt werden. Zum ersten Mal zieht ein westdeutscher Landkreis nach und greift auf ein Instrument zurück, das im Osten bereits bewährte Strukturen zeigt. Ob daraus ein bundesweiter Trend wird, hängt nun vom juristischen Ausgang in Thüringen und vom politischen Willen in den Ländern ab.
Kommunen stehen zwischen Pragmatismus und Paragraphen. Doch der Tenor aus der Praxis ist eindeutig:
Wer arbeiten kann, sollte auch arbeiten dürfen – und manchmal auch müssen.






