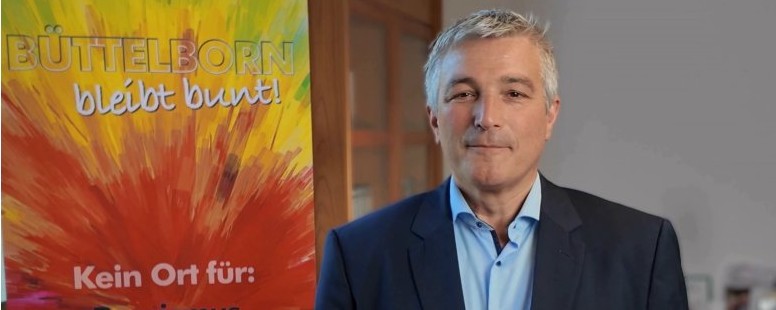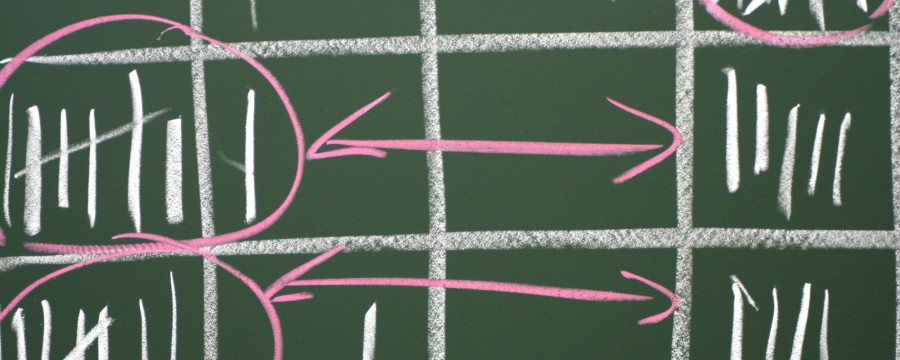Fachkräftemangel in Kommunen
Warum so viele Stellen unbesetzt bleiben – und was jetzt helfen kann
Warum gibt es in den Kommunen so viele offene Stellen?
Es gibt aktuell langfristige und kurzfristige Trends, die den Arbeitsmarkt beeinflussen. Wir stecken in einer hartnäckigen Rezessionsphase, die den Arbeitsmarkt eher kurzfristig dahingehend beeinflusst, dass Unternehmen vorsichtiger beim Einstellen von neuem Personal werden. Hier kann der öffentliche Dienst sogar mit sicheren Arbeitsplätzen punkten.
Langfristig sind die Trends der demografische Wandel, die Digitalisierung und die Dekarbonisierung. Davon trifft der demografische Wandel die öffentlichen Verwaltungen besonders stark. 2004 waren elf Prozent der Beschäftigten im öffentlichen Dienst 55 Jahre und älter. Jetzt sind es 24 Prozent. Die Welle der Pensionierungen und Verrentungen hält an.
Das heißt die anderen beiden langfristigen Trends wirken sich auf den öffentlichen Dienst nicht aus?
Die Digitalisierung und die Dekarbonisierung wirken auf den öffentlichen Dienst in der Form ein, dass sie die Arbeitsbereiche und die Art wie dort gearbeitet wird verändern. Dadurch kommt es viel häufiger zu einem Phänomen, das wir „Mismatch“ nennen. Das bedeutet: Die Fähigkeit der zur Verfügung stehenden Arbeitskräfte passt nicht zu den Anforderungen offener Stellen. So entsteht ein Fachkräftemangel, auch wenn in reinen Zahlen vielleicht ausreichend Fachkräfte verfügbar wären. Aktuell haben wir 1,2 Millionen offene Stellen und gleichzeitig steigt die Zahl der Arbeitslosen.
Bei Stellenausschreibungen hat das aktuell zur Folge, dass bei solchen, für die es eine höhere Qualifikation benötigt, nur noch rund 40 Prozent der eingehenden Bewerbungen geeignet sind.
Welche Auswirkungen der Trends auf den öffentlichen Dienst sind noch zu spüren?
Die Zahl der Bewerbungen, die auf eine Ausschreibung kommen, steigt aktuell deutlich an. Das liegt daran, dass es dem Arbeitsmarkt schlecht geht und die Zahl der Stellenausschreibungen sinkt. Das ist aber der Rezession geschuldet und damit ein kurzfristiger Trend.
Wie viele offene Stellen gibt es im öffentlichen Dienst?
Im ersten Quartal 2025 waren es 49.000 offene Stellen.
Wie sieht es denn auf dem Ausbildungsmarkt aus?
Hier driften Angebot und Nachfrage auseinander. Seit 2018 gehen die Bewerbungen deutlich zurück – auch wenn sich der Markt zuletzt leicht erholt hat. Wie haben 466.000 offene Ausbildungsstellen (5,3 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum 2024) und 400.000 Bewerberinnen und Bewerber. Das ist unter anderem geringen Geburtenraten geschuldet.
Was muss jetzt geschehen, um den Fachkräftemangel zu überwinden?
Gemeinsam mit meinem Kollegen Lutz Schneider habe ich eine Studie dazu veröffentlicht, wie viel Zuwanderung wir benötigen, um das fehlende Fachkräftepotenzial auszugleichen. Dabei haben wir Effekte wie die zunehmende Digitalisierung und Automatisierung bereits eingerechnet. Unseren Berechnungen zufolge benötigen wir jährlich eine Nettozuwanderung von 288.000 Menschen. Da viele Menschen nur kurzfristig in Deutschland bleiben, muss die Bruttozuwanderung jedoch deutlich höher liegen. Wir reden eher von rund einer Million Menschen.
Dabei ist auch entscheidend, wie gut diese Zuwanderung vorbereitet wird. Je besser wir diese vorbereiten, desto weniger Zuwanderung benötigen wir, um den Fachkräftebedarf zu decken.
Sind Flüchtlinge Teil dieser Zuwanderung?
Aus meiner Sicht kann man Flüchtlinge erst einmal nicht in der Form in so eine Statistik einrechnen, weil es sich zunächst einmal um eine Migration aus humanitären Gründen handelt. Wir sehen aber auch, dass Flüchtlinge nach einigen Jahren in Deutschland relativ gute Erwerbsquoten erreichen. Meine Kollegin Yuliya Kosyakova sowie meine Kollegen Herbert Brücker und Philipp Jaschke haben sich eingehender damit beschäftigt und festgestellt, dass sich die Beschäftigungsquote der 2015 nach Deutschland zugezogenen Schutzsuchenden neun Jahre nach dem Zuzug auf 64 Prozent belief, im Vergleich zu 70 Prozent in der Gesamtbevölkerung.
Es ist wichtig, dass wir Menschen mit einer langfristigen Bleibeperspektive schnell in den Arbeitsmarkt bringen. Gleichzeitig muss darauf geachtet werden, dass sie die nötigen Qualifikationen nachholen können. Etwa Deutsch lernen. Wenn wir das nicht gewährleisten, landen diese Menschen in Helferberufen und helfen nicht den Fachkräftemangel einzudämmen.
Haben wir eigentlich auch einen Arbeitskräftemangel?
Von einem Arbeitskräftemangel können wir aktuell nicht sprechen. Auch das hängt mit dem Phänomen Mismatch zusammen. Über die Hälfte der Arbeitslosen suchen ausschließlich im Bereich Helferbesuche nach einer neuen Beschäftigung – auch wenn sie höhere Qualifikationen vorweisen können. Das liegt daran, dass ihre Qualifikationen entweder nicht zu den gesuchten Qualifikationen gehören oder Veränderungen im eigenen Beruf verpasst wurden. Deshalb ist es wichtig, dass wir stark auf die Weiterbildung setzen.
Aktuell erhöht sich die Zahl der Langzeitarbeitslosen wieder. Da müssen wir mit Weiterbildungen gegenwirken. Denn Langzeitarbeitslosigkeit gefährdet den Fachkräftemarkt.
Das heißt Weiterbildung und Zuwanderung sind die wichtigsten Motoren für ausreichend Fachkräfte?
Es sind die wichtigsten Bausteine, ja. Dazu kommen aber auch weitere Faktoren, die man berücksichtigen sollte: Es gibt ein gesellschaftliches Bedürfnis weniger Stunden in der Woche zu arbeiten. Wenn Jobs interessant für Bewerberinnen und Bewerber sein sollen, sollte man darauf eingehen. Auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf – ob es die Erziehung von Kindern oder die Betreuung von Eltern ist – muss stärker in den Blick genommen werden.