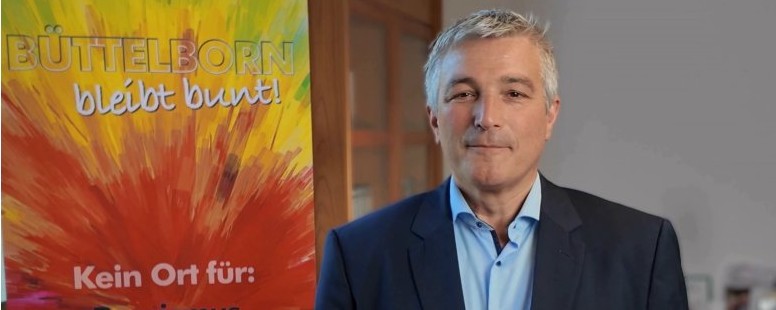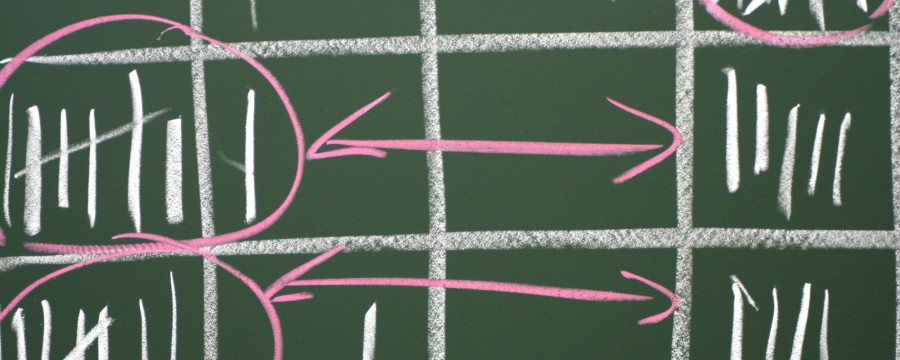Interview
Fachkräftemangel: Hier finden Kommunen Unterstützung
An wen können sich Kommunen wenden, wenn sie Probleme mit der Suche nach Fachkräften haben?
Ich empfehle bei der Suche nach Fachkräften auch die Unterstützung von lokalen Arbeitgeber-Services zu nutzen.
Gibt es Personengruppen, die man besonders in den Fokus nehmen sollte?
Je nach Region hat man mit der einen oder der anderen Personengruppe mehr Glück. Je nach Region kann sich das Arbeitskräfte-Potential zwischen den verschiedenen Personengruppen unterscheiden. Es lohnt sich daher für eine erfolgreiche Suche nach Arbeitskräften, zuerst alle Gruppen in den Blick zu nehmen.
Welchen Tipp würden Sie einem Arbeitgeber geben, der keine geeigneten Bewerberinnen und Bewerber findet?
Häufig bewerben sich Menschen auf Stellenausschreibungen, die nicht alle geforderten Qualifikationen mitbringen – bestimmte Aufgaben also nicht 1:1 übernehmen können. Arbeitgeber stehen dann vor der Entscheidung, die ausgeschriebene Stelle nicht zu besetzen oder den Bewerbenden dennoch eine Chance zu geben. In solchen Situationen lohnt es sich, einen genauen Blick auf die Tätigkeiten und die Arbeitnehmenden zu werfen. Teils können Aufgaben innerhalb des Teams anhand der Stärken so verteilt werden, dass eventuell fehlende Teilqualifikationen durch strategischen Personaleinsatz weniger stark ins Gewicht fallen.
Und was man zusätzlich berücksichtigen sollte: Auch geringqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eignen sich oft für eine Weiterbildung zur Fachkraft. Die übrigbleibende Stelle für eine geringer qualifizierte Person ist in der Regel leichter neu zu besetzen.
Bei Weiterqualifizierungsmaßnahmen kann eventuell die Förderung der Bundesagentur für Arbeit in Anspruch genommen werden. Das kann im Einzelfall mit dem Arbeitgeber-Service geklärt werden. Kommt eine Förderung zustande, können Fahrtkosten, Kinderbetreuung und Teile der Weiterbildung gefördert werden.
Wie viel bringt es, selbst auszubilden?
Bei uns sind aktuell 140.000 Ausbildungssuchende verzeichnet, die ohne Ausbildungsplatz sind. Das ist ein Anstieg um 15,1 Prozent.
Gleichzeitig: Jugendliche, die eine Ausbildung suchen, gibt es zwar viele, sie sind aber regional ganz unterschiedlich verteilt. In überalterten Regionen wird man in dieser Personengruppe ein deutlich kleineres Potenzial vorfinden. Diese Personengruppe ist auch nicht sehr mobil für die Arbeit: Ausbildungsplätze sind in der Regel so entlohnt, dass ein Umzug in eine andere Stadt erschwert ist. Viele Auszubildende wohnen, unserer Erfahrung nach, im Elternhaus. Es handelt sich deshalb in vielen Berufsfeldern um einen sehr stark regionalen Markt.
Wie geht eine Kommune am besten auf potenzielle Auszubildende zu?
Um Auszubildende für sich zu gewinnen, ist er besonders ratsam, Ausbildungsmessen zu besuchen und die Kommune als Arbeitgeberin in Schulen vorzustellen – also dort hinzugehen, wo sich die Jugendlichen befinden.
Die Ausbildung in Teilzeit wird aktuell noch von den wenigsten Arbeitgebern angeboten. Es ist aber sinnvoll diese Option zu erwägen, da man ansonsten einen Pool an möglichen Bewerberinnen und Bewerbern bei der Suche von vornherein ausschließt. Früher hat es einer Begründung bedurft, um als Arbeitgeber eine Teilzeitausbildung anzubieten – So zum Beispiel die Pflege von Angehörigen. Diese Begründungspflicht ist mittlerweile weggefallen.
Und welches Potenzial haben Flüchtlinge im Kampf gegen den Fachkräftemangel?
Es gibt aktuell 501.000 Arbeitssuchende in Deutschland mit einer Staatsangehörigkeit aus den acht größten Asylherkunftsländern. Das Potenzial ist also groß.
Bei den meisten Berufen in der Kommune ist es wichtig, dass Fachkräfte gute Deutschkenntnisse mitbringen. Das ist bei Geflüchteten, die erst seit Kurzem in Deutschland sind, oft nicht der Fall. Im Bauhof zum Beispiel gibt es auch Berufe, bei denen die Sprache weniger im Vordergrund steht.
Die Bundesagentur für Arbeit bietet hier Unterstützung an: Wenn eine Kommune fähige Bewerberinnen und Bewerber findet, denen aber die nötigen Deutschkenntnisse noch fehlen oder deren Ausbildung in Deutschland nicht anerkannt wird oder im Heimatland noch nicht abgeschlossen wurde, kann sich die Kommune für eine Beratung an die Bundesagentur für Arbeit wenden.
Im Gespräch können die Vermittlungsfachkräfte dann Optionen aufzeigen, ob zum Beispiel ein Deutschkurs gefördert werden kann oder eine assistierte Ausbildung in Frage kommt. Um die Zusammenarbeit erst einmal auszutesten, kann über die Agentur für Arbeit unter Umständen ein Probearbeiten arrangiert werden.
Wie sieht es mit Fachkräfteagenturen aus, die Fachkräfte aus dem Ausland anwerben?
Es gibt sehr gute Agenturen, auf die öffentliche Arbeitgeber hier zugreifen können – ganz besonders in Bereichen wie Pflege und Kita. Es gilt trotzdem die jeweilige Agentur vorsichtig auszuwählen und sich besonders die Referenzen anzusehen. Ideal ist es, wenn man im Vorhinein mit einem Arbeitgeber sprechen kann, der mit der Agentur bereits zusammengearbeitet hat und eine eigene Erfahrung mitteilen kann.
Ein Risiko ist das sogenannte „Braindrain“ in dem Land, aus dem die Fachkräfte abgezogen werden. Wie sehr die Agenturen mit den Arbeitsverwaltungen vor Ort zusammenarbeiten, um dies zu vermeiden, ist sehr unterschiedlich gelagert.
Es lohnt sich hier auch, mit der lokalen Arbeitsagentur Kontakt aufzunehmen. Diese haben teils Kontakte, die helfen können, Fachkräfte aus dem Ausland einzustellen.
Wenn man Fachkräfte aus dem Ausland holt, gilt es zu beachten, dass so ein Projekt nicht beendet ist, wenn die Fachkraft in Deutschland ankommt. Das bedeutet auch eine soziale Verantwortung. Diese Menschen haben keine sozialen Kontakte. Wir haben zum Beispiel gesehen, dass viele Fachkräfte, die aus Spanien nach Deutschland geholt wurden, nach wenigen Jahren in ihre Heimat zurückgekehrt sind, weil sie sich einsam fühlten.
Es ist empfehlenswert Kümmererstrukturen aufzubauen und so dabei zu helfen, dass diese Menschen eine Anbindung an die Zivilgesellschaft bekommen.