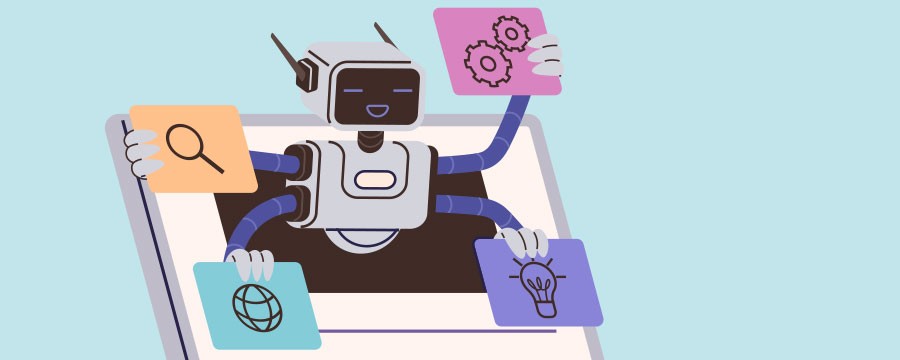Flüchtlingscamp Moria - Helfen vor Ort
Text: Janina Salden
„Desaströs“, „abscheulich“, „Schande Europas“, „humanitäre Katastrophe“, „Guantánamo of Europe“, „Freiluftgefängnis“ – oder einfach nur die „Hölle“. Für das Flüchtlingscamp Moria auf der griechischen Insel Lesbos kursieren viele Umschreibungen. Nur als „Tor nach Europa“ – wie die griechischen Inseln einst von Geflüchteten wahrgenommen wurden – gilt Lesbos heute nirgendwo mehr. Moria ist eines der fünf Erstaufnahmelager, die sogenannten europäischen HotSpots auf den griechischen Inseln in der östlichen Ägäis – konzipiert als Durchgangsstation, in der sich die Ankommenden höchstens 72 Stunden zur Identitätsfeststellung aufhalten sollen. Aus diesen drei Tagen sind mittlerweile für einige Geflüchtete über zwei Jahre geworden. Die Flüchtlinge dürfen sich auf der Insel frei bewegen, sie aber während des laufenden Asylverfahrens nicht verlassen. Zugleich kommen fast tägliche neue Boote mit weiteren Flüchtlingen an den Küsten an. Moria ist chronisch überbelegt; die knapp 3000 Plätze müssen sich in der Regel 7000 bis 9000 Menschen teilen. Unter Ihnen etwa ein Drittel Kinder. Es mangelt an Platz, Hygiene, Essen, medizinischer Versorgung. Neben dem „offiziellen“ Camp unter der Leitung der griechischen Regierung, umzäunt von Stacheldraht, bewacht von Militär und Polizei, hat sich auf dem angrenzenden Olivenhain ein „wildes“ Camp gebildet. Dieser unter den Flüchtlingen als „Dschungel“ bekannte Teil ist menschenunwürdig und vor allem nicht für den Winter gemacht. Im letzten Jahr sind hier Menschen erfroren. Das dies auch in diesem Jahr wieder passieren wird, ist sehr wahrscheinlich.
Kommunale Grenzen im Flüchtlingscamp
Bis zum EU-Türkei-Abkommen von März 2016 war Griechenland ein Durchgangsland. Seit Inkrafttreten des Abkommens hat sich insbesondere durch den türkischen Grenzschutz der Zustrom an Flüchtlingen deutlich verringert. Der Geschäftsführende Direktor der Region Nordägäis, Giorgos Kampouris, erklärt, dass dennoch die Zahl der Flüchtlinge, die jeden Tag neu hinzukommt jene Anzahl, die mit abgeschlossenem Asylverfahren die Insel wieder verlassen, deutlich übersteigt. Die Überfüllung des Camps Moria ist die logische Konsequenz. Direktor Kampouris sind wie allen anderen Kommunalpolitikern die Hände gebunden; ihre Hilferufe blieben bisher ungehört. Finanzielle und organisatorische Unterstützung der griechischen Regierung gibt es für die Kommunen nicht. Dabei ist die Insel Lesbos mehrfach herausgefordert: Die griechische Finanzkrise und die Stigmatisierung als „Flüchtlingsinsel“ haben den Tourismus drastisch einbrechen lassen. Die Arbeitslosigkeit ist hoch, das letzte Erdbeben hat deutliche Spuren hinterlassen. Hinzu kommen immer mehr Verteilungskonflikte zwischen der einheimischen Bevölkerung und den Flüchtlingen. Die Grenzen der Akzeptanz scheinen erreicht zu sein. Kommunalpolitikern der griechischen Inseln bleibt nicht mehr, als an die Regierung in Athen zu appellieren.
In Athen treffen wir den griechischen Minister für Migrationspolitik, Dimitris Vitsa. Die Europäische Union hat Griechenland für die Versorgung und Unterbringung der Flüchtlinge auf drei Jahre verteilt 1,6 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Ist mehr Geld erforderlich, um die Situation der Flüchtlinge auf den ost-ägäischen Inseln zu verbessern? Natürlich könne man immer mehr Geld gebrauchen, so der Minister, aber was tatsächlich fehle, seien Übersetzer – um die Asylverfahren zu beschleunigen – und Ärzte, 120 wären gut. Einer der wenigen Punkte, bei denen sich die griechische Regierung und die auf Lesbos agierenden Hilfsorganisationen einig sind. Für die rund 8000 Flüchtlinge sind im Schnitt zwei Ärzte im Camp eingesetzt – nicht einmal die eigentlich verpflichtende Erstuntersuchung der Flüchtlinge kann mit diesem Personalschlüssel bewältigt werden. Der rettende Anker für viele Flüchtlinge ist die „Mobile Klinik“ von „Ärzte ohne Grenzen“ vor dem Eingang des Flüchtlingscamps. Hier schafft man es mit einer Handvoll medizinischem Personal täglich bis zu 120 Patienten, hauptsächlich Kinder, zu behandeln. Die medizinische Versorgung sollte nun doch aber eigentlich zwingend durch die griechische Regierung gewährleistet werden! Die staatlichen Vertreter der Camp-Leitung sind hier nur bedingt einsichtig. Man können keine weiteren griechischen Ärzte entsenden, heißt es lapidar. Die Zustände seien nicht „ideal“, aber auch nicht so dramatisch, wie in den Zeitungen zu lesen sei: Man könne es eben nicht allen recht machen, es handele sich schließlich nicht um ein Hotel. Die Gewaltausbrüche habe man unter Kontrolle, für Suizid und Suizidversuche gebe es keine Hinweise, lange Wartezeiten bei der Essenausgabe gebe es nicht. Hygienische Mängel könne auch die Regierung nicht verhindern, wenn so viele Menschen auf engem Raum zusammenleben. Dieses Gespräch mit Verantwortlichen im Camp Moria ist nicht das erste Mal, dass einen das Gefühl beschleicht, eine Optimierung der Lebensbedingungen in Moria ist gar nicht gewollt. Es ist ein offenes Geheimnis, dass die griechische Regierung die Zustände nicht maßgeblich verbessern will wird, in der Annahme, damit eine abschreckende Wirkung auf jene zu erzeugen, die eine Flucht nach Europa übers Meer planen.
Europäische Grenzen im Flüchtlingscamp
Minister Dimitris Vitsa sieht die Lösung für das überfüllte Camp in der Beschleunigung der Asylverfahren. Die Bedingungen sollen sich dadurch verbessern, dass weniger Menschen sich den Platz und die Versorgungsleistungen teilen müssen. Dafür brauche Griechenland mehr personelle Unterstützung von den anderen Mitgliedsstaaten der EU. Zudem müssen die Flüchtlinge mit positivem Bescheid auf die anderen europäischen Staaten verteilt werden – so war es abgemacht, betont der Migrationsminister. Hier ist die europäische Grenze erreicht, die Grenze der europäischen Solidarität. Die EU-Mitgliedsstaaten konnten sich auf die Abgrenzung in Form von Grenzbewachung einigen, nicht aber auf die Verteilung der Flüchtlinge. Ein gemeinsames Agieren in der Asylpolitik ist nicht in Sicht. „Die Flüchtlinge sind ein Test für Europa“, sagt ein Oppositionspolitiker der Nea Dimokratia. Diese Testphase dauert nun aber schon viel zu lange an und könnte nachhaltige Konsequenzen für den europäischen Zusammenhalt haben. Wer das verhindern will, sollte schnell unter Beweis stellen, dass die europäische Grenze im Meer hinter Lesbos liegt und nicht davor – im Namen der Menschlichkeit und im Namen der europäischen Solidarität.