
Interkommunale Zusammenarbeit
Kooperation statt Konkurrenz
Kommunen können viele Aufgaben besser gemeinsam lösen als allein. Ob Infrastruktur, Digitalisierung, Energieversorgung oder Verwaltung: Interkommunale Zusammenarbeit verbindet Kräfte, schafft Synergien und entlastet Haushalte. Sie ermöglicht vor allem kleineren Städten und Gemeinden, Aufgaben effizienter zu bewältigen, Fachwissen zu bündeln und professionelle Strukturen aufzubauen. Die folgenden Beispiele zeigen, wie vielfältig und erfolgreich solche Kooperationen bereits heute sind – und wie sehr Bürgerinnen und Bürger, Verwaltungen und ganze Regionen davon profitieren.
Zwei Gemeinden, ein Friedhof

St. Alban und Gerbach in Rheinland-Pfalz betreiben einen gemeinsamen Friedhof zwischen beiden Orten. Die Anlage wird seit Jahrhunderten von den Gemeinden genutzt, getrennte Bereiche gibt es nicht. Die Verwaltung liegt direkt bei den beiden Bürgermeistern Petra Becher (St. Alban) und Daniel Heinz (Gerbach). Bei einem Todesfall ist die jeweilige Ortsgemeinde zuständig, Termine und Abläufe werden telefonisch oder per WhatsApp abgestimmt. Die Pflege übernehmen abwechselnd die Gemeindearbeiter. Über größere Maßnahmen wie Baumfällungen, Umbauten oder neue Grabfelder entscheiden beide Räte nach einem Ortstermin. Die Kosten werden nach Einwohnerzahl geteilt: Gerbach trägt drei Fünftel, St. Alban zwei Fünftel. Grundlage der Kooperation sind klare Zuständigkeiten, gegenseitiges Vertrauen und regelmäßige Abstimmung. Gerbachs Bürgermeister Heinz sagt: „Ein großer Vorteil unserer Kooperation ist, dass dadurch die Kostenverteilung auf eine breitere Basis gestellt wird.“
Millionen durch gemeinsamen Gewerbepark

Der Zweckverband Eichwald in Baden-Württemberg hat sich für seine vier Verbandskommunen längst zum Geldsegen entwickelt.
Oberriexingen und Sersheim erhielten 2025 Ausschüttungen von rund 1,5 Millionen Euro. Seit 2011 flossen 56,27 Millionen Euro aus Steuern und 57,7 Millionen Euro aus Grundstücksverkäufen an die Kommunen. 1994 gründeten Sachsenheim, Oberriexingen und Sersheim den Zweckverband und kauften gemeinsam eine 100 Hektar große ehemalige US-Militärliegenschaft. „Das Interesse war groß, denn auch damals waren die freien Flächen für Gewerbe schon knapp", erinnert sich Jürgen Scholz, Bürgermeister von Sersheim. Nach ersten erfolgreichen Ansiedlungen kaufte sich die Stadt Bietigheim-Bissingen ein. Heute arbeiten knapp 3.000 Menschen im Gewerbepark. „Der Etatplan ist sehr solide aufgestellt. Man muss sich um den Zweckverband wirklich keine Sorgen machen“, betont Oberriexingens Bürgermeister Ron Keller. Der Gewerbepark ist bereits mehrfach erweitert worden.
Kommunen bündeln Energie
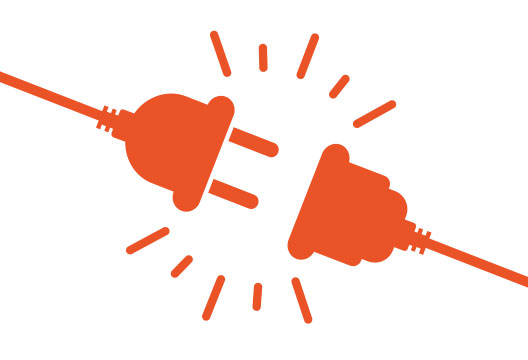
Neun Kommunen aus dem Landkreis Neu-Ulm – Bellenberg, Illertissen, Kellmünz, Nersingen, Oberroth, Osterberg, Roggenburg, Unterroth und Weißenhorn – wollen gemeinsam die Energiewende gestalten. Sie planen ein Regionalwerk. Das Ziel: Energieprojekte in kommunaler Hand umsetzen. „Warum sollen Investoren die Anlagen betreiben, wenn wir das selbst können?“, beschreibt Illertissens Klimaschutzmanager Simon Ziegler den Ansatz. „So bleiben Wertschöpfung und Entscheidungsfreiheit in der Region.“ Jede Kommune bringt eigene Projekte ein, die im Rahmen eines Businessplans geprüft werden. Das Regionalwerk soll zum 1. Januar 2026 gegründet werden. Als Projektpartner werden die ILE Iller-Roth-Biber Bürgerenergie eG, Grundstückseigentümer und weitere Bürger eingebunden. In einem ersten Schritt konzentrieren sich die bayerischen Kommunen auf Photovoltaik, Stromspeicher und E-Ladesäulen. Auf dieser Basis sollen in einem zweiten Schritt die Bereiche Wärme und Mobilität ausgebaut werden.
Beim Digitalisieren vom anderen lernen
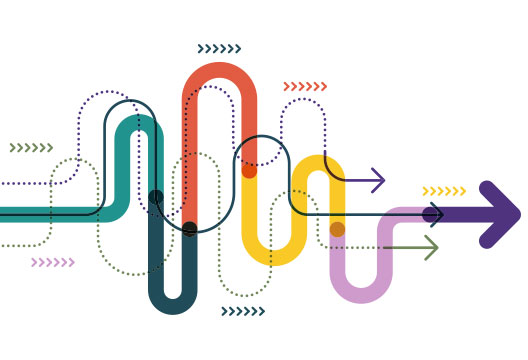
Lübeck, Rostock, Stralsund und Wismar machten 2023 den Anfang, inzwischen sind auch Neubrandenburg, Schwerin und Kiel Teil des Netzwerks „Smarte Hanse“. Sie alle verbindet die Idee, Digitalisierung nicht isoliert zu denken, sondern voneinander zu lernen und gemeinsame Strukturen zu nutzen. In Lübeck messen Sensoren die Wasserqualität von Seen – die Daten laufen auf der Smart-City-Plattform zusammen, wo Bürger vor dem Badeausflug die aktuellen Werte abrufen können. In Neubrandenburg werden weitere Sensoren erprobt, die etwa den PH-Wert ermitteln . Auch CO₂-Sensoren in Schulen und Kitas oder Verkehrsinfos zur Lübecker Klappbrücke zeigen, wie digitale Lösungen geteilt werden. Viermal im Jahr treffen sich die Entscheider, monatlich tauschen sich Beschäftigte beim „Hanse-Schnack“ aus. „Es wird offen über Herausforderungen gesprochen, sodass man voneinander lernt", sagt Stefan Ivens, Chief Digital Officer von Lübeck. Das spare Zeit, Ressourcen und Steuergelder.
Kleine Kommunen, große Schulen

27.000 Einwohner in 14 Kommunen – vom 180-Seelen-Dorf bis zur 14.500-Einwohner-Stadt: Der Verwaltungsverband Langenau in Baden-Württemberg zeigt, wie interkommunale Zusammenarbeit funktioniert – unter anderem im Bereich Schule. „Wir arbeiten schon immer nach dem Motto ‚kurze Beine, kurze Wege'", erklärt der Geschäftsführer des Verwaltungsverbands, Hermann Schmid. Erstmal versucht jede Kommune die nötigen Schulen vorzuhalten. Wenn das nicht geht, schließen sich kleine Zweckverbände zusammen, die nah beieinander sind. Erst wenn das nicht mehr ausreicht, übernehmen wir die Schulträgerschaft.“ Der Verwaltungsverband ist aktuell Träger einer Gemeinschaftsschule und eines Sonderpädagogischen Bildungszentrums, die die Kommunen einzeln nicht unterhalten könnten. Investitionen wie ein 7,4-Millionen-Euro-Anbau für die Gemeinschaftsschule, die viel Zulauf erfährt, lassen sich so stemmen.
Kurze Wege statt langer Verfahren

Seit März 2023 betreiben die baden-württembergischen Kommunen Abstatt, Beilstein, Ilsfeld und Untergruppenbach eine gemeinsame Baurechtsbehörde im Gemeindeverwaltungsverband Schozach-Bottwartal. Statt über das Landratsamt zu gehen, werden Bauanträge nun direkt vor Ort bearbeitet. „Wir kümmern uns hier um vier Kommunen statt 40, wie es beim Landratsamt ist. Wir sind näher an den Bürgerinnen und Bürgern und die Verwaltungen der Kommunen sind näher an uns. Es gibt für alle einen ‚kürzeren Draht‘“, sagt Behördenleiter Thomas Stutz. Die enge Abstimmung stärkt die kommunale Selbstverwaltung und erhöht die Servicequalität. Der Weg dorthin war kein Sprint: Räume finden, IT aufbauen, LKW-weise Akten sortieren, digitalisieren und archivieren, die Zuständigkeitsübertragung vom Landratsamt auf die neue Behörde. Doch das Ergebnis überzeugt: Schon nach wenigen Wochen gab es positive Rückmeldungen aus Rathäusern und Bürgerschaft.






