
Kriegsgefahr
Wie Kommunen sich auf Ernstfall vorbereiten sollten
In Deutschland geht die Angst um. Der Krieg in der Ukraine und der Konflikt im Nahen Osten beherrschen die Schlagzeilen. Dazu kommen Naturkatastrophen wie im Ahrtal. Und immer wieder wird in der Öffentlichkeit die bange Frage gestellt: Sind wir genug vorbereitet? Was können wir im Fall des Falles tun? Dass diese Frage auch in Deutschlands Rathäusern gestellt wird, ist dabei selbstverständlich. Doch Experten sind pessimistisch, was die Fähigkeit der Städte und Gemeinden angeht, sich auf Katastrophen vorzubereiten.
Kommunen kommen an ihre Grenzen
„Kommunen sind nicht resilient“, sagt der Professor für Krisen- und Katastrophenforschung am Institut für geographische Wissenschaften der Freien Universität Berlin, Martin Voß. „Sie sind im Alltag weit weg von der realen Gefährdungslage, mit der sie im Fall des Falles konfrontiert sind.“ Ein Bürgermeister habe genug Alltagsprobleme, um die er sich kümmern müsse – vom Kindergartenbau bis zur Hundesteuer, von der Haushaltslage seiner Gemeinde bis zum Neubau eines Radwegs. „Damit hat der Bürgermeister genug zu tun“, sagt Voß. „Und er hat im Regelfall schon heute auf allen Ebenen seiner Verwaltung zu wenig Leute für das Tagesgeschäft: Das ist der Normalzustand einer Kommune in Deutschland.“ Unter solchen Umständen könnten Kommunen keine Resilienz für den Verteidigungsfall, den Krisen- oder Katastrophenfall aufbauen. Sie kämen schon im Alltag an ihre Grenzen.

Die Kommunen brauchen für die
Krisenvorsorge dringend Geld und Personal.“
Runder Tisch in Kommunalverwaltungen
Wie können Kommunen sich trotz der knappen Ressourcen auf einen Ernstfall vorbereiten? „Der wichtigste Ansatz, um eine Kommune krisenfit zu bekommen, ist nicht, eine Liste mit Dingen zu erstellen, die ein Bürgermeister machen kann“, sagt Voß. „Das würde nicht helfen, weil am Ende für alle diese Dinge die Ressourcen fehlen.“ Am wichtigsten sei es vielmehr, über die knappen Ressourcen öffentlich zu reden. „Die Kommunen brauchen für die Krisenvorsorge dringend Geld, sie brauchen Personal“, sagt Voß. „Die Gesellschaft muss sich entscheiden, ob sie unvorbereitet in Katastrophen schlittern will, oder ob man darin ein Umverteilungsproblem sieht, das gelöst werden muss.“
Der Professor rät deswegen dazu, dass es in Gemeinde- und Stadtverwaltungen einen „Runden Tisch“ zur Resilienz gibt. Vertreter der Behörden, der Zivilgesellschaft und der kritischen Infrastruktur, aber auch des Katastrophenschutzes oder der Hilfsorganisationen müssten regelmäßig zusammenkommen und besprechen, was in der Kommune getan werden muss. „Das muss dann öffentlich kommuniziert werden“, sagt Voss. „Dann kann sich allmählich ein Mindset ändern: Man spricht über Lücken und Schwachstellen und geht sie an.“ Entfernt vergleichbar sei ein solcher „Runder Tisch“ mit einem permanent tagenden Krisenstab. „Für den Katastrophenschutz haben wir eine Architektur, für den Zivilschutz auch“, sagt Voß. „Aber für die komplexe Krise, wie wir sie etwa in der Corona-Pandemie erlebt haben, fehlt uns die Vorbereitung.“
Projekt Krisenfit an der Bergischen Universität Wuppertal
Bei seinen Forschungen zu dem Thema kooperiert Voß mit dem Projekt „Krisenfit“ an der Bergischen Universität Wuppertal. Am Lehrstuhl von Prof. Frank Fiedrich beschäftigen sich die wissenschaftlichen Mitarbeiter Alexandra Schmitt und Niklas Frings explizit mit der Frage, wie sich Kommunen auf Krisen vorbereiten können. „Wichtig ist, dass das Thema Krise in der Kommune präsent ist”, sagt Schmitt. Die Menschen in der Verwaltung sollten stärker darüber nachdenken, wo und wie sie in ihrer Rolle in einer Krise gebraucht werden könnten. „Wichtig ist aber auch das Wissensmanagement“, sagt Schmitt. Denn die deutschen Verwaltungen würden in den nächsten Jahren – bedingt durch den Ruhestandsteintritt der sogenannten „Babyboomer“ - eine Welle von Pensionierungen erleben. „Deren über die letzten Jahrzehnte angesammelten Erfahrungen, deren Wissen darf nicht verloren gehen“, sagt Schmitt. Oft wüssten leitende Mitarbeiter, an wen sie sich in einer Katastrophen- oder Krisensituation wenden könnten. Mindestens ebenso oft sei das aber nirgendwo aufgeschrieben. Und dann kommt die Krise, und der Nachfolger weiß nicht, von welchem Bauhof welche Technik wie bestellbar ist.

Krisenmanagement ist eine
Aufgabe der Gesamtverwaltung.“
Alexandra Schmitt, wissenschaftliche
Mitarbeiterin an der Bergischen Universität Wuppertal.
Krisenvorbereitung ist mehr als Katastrophenschutz
„Eine Krise ist nicht nur Sache des Katastrophenschutzes“, betont die wissenschaftliche Mitarbeiterin. „Krisenmanagement ist eine Aufgabe der Gesamtverwaltung.“ Wenn eine Krise geschehe, müsse die Verwaltung aus ihrer Alltagsorganisation in eine andere Organisationsstruktur wechseln können. „Und Krisenmanagement bedeutet nicht nur: Wir haben da ja den Krisenstab“, so Schmitt. „Das, was im Krisenstab entschieden wird, muss ja auch irgendwo wieder umgesetzt werden: Das heißt, die einzelnen Abteilungen müssen auch so aufgestellt sein, dass sie im Krisenfall zumindest im Rahmen eines gewissen Notbetriebes weiterhin Kerndienstleistungen oder Kernprozesse am Laufen halten können.“ Die Wuppertaler Wissenschaftler sind deswegen überzeugt davon, dass es in jeder Kommunalverwaltung eine Stabsstelle oder ein eigenes Amt für Krisenvorbereitung geben sollte. Dessen Aufgabe sollte es zum Beispiel sein, Krisenübungen vorzubereiten, durchzuführen und auszuwerten. „In großen Unternehmen finden regelmäßig Trainings für den Katastrophenfall statt“, sagt Schmitt. „Aber in vielen Kommunen übt den Ernstfall nur die Feuerwehr.“
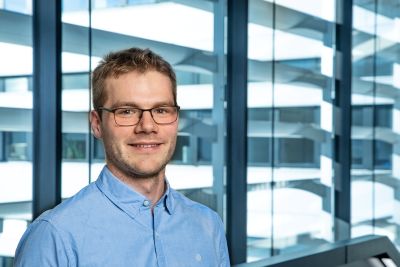
In jeder Kommunalverwaltung sollte es eine Stabsstelle oder ein eigenes Amt für Krisenvorbereitung geben."
Niklas Frings, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Bergischen Universität Wuppertal
Um den Kommunen die Krisenvorbereitung zu erleichtern, arbeitet die Bergische Hochschule an einem „Selbst-Evaluations-Tool“. „Anhand von relativ niedrigschwelligen Fragen soll man mit dem Tool klären können, wie sehr die jeweilige Abteilung des Rathauses oder der Kommune auf eine Krise vorbereitet ist“, sagt Niklas Frings. „Von unten angefangen, sollen das alle Abteilungen machen, und ihre Ergebnisse an die nächsthöhere Ebene weitergeben.“ Am Ende könne man dann sehen, wie es in der Kommune um die Krisenvorbereitung stehe, was noch gemacht werden müsste, und welche Verbesserungsmöglichkeiten es gebe. „Es ist der Versuch, das Gleichgewicht zu finden zwischen der Erkenntnis, etwas tun zu müssen, und der allgemeinen Ressourcenknappheit in den Kommunen“, sagt Frings. Denn am Ende des Tages sei alle Krisenvorbereitung eben nur umsetzbar, wenn sie auch personell und mit den nötigen finanziellen Ressourcen untersetzt ist.







