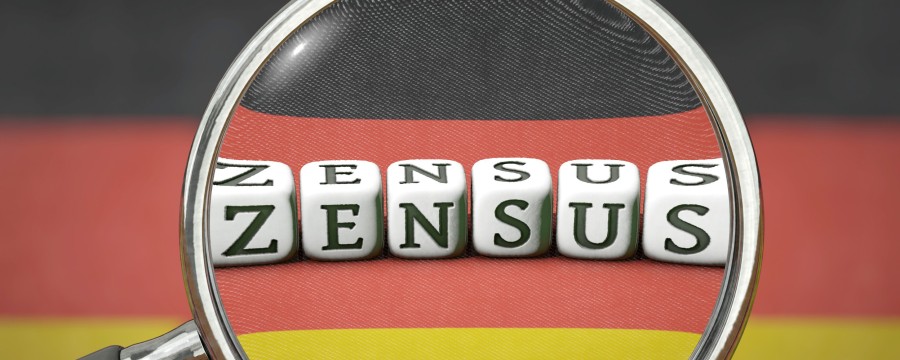Recht aktuell
Gericht: Kläger muss Schottergarten entfernen
Kläger müssen Schottergarten beseitigen
Vor dem Verwaltungsgericht bekam die Stadt schließlich Recht. Die Gartenbesitzer beantragten daraufhin, vor dem zuständigen Oberverwaltungsgericht die Berufung. Doch sie wurden erneut enttäuscht. Der 1. Senat des niedersächsischen OVG lehnte den Antrag auf Berufung ab. So bleibt es bei der Entscheidung der Stadt Diepholz, die das Verwaltungsgericht Hannover gestützt hatte.
Kiesbeete statt Grünflächen
Die Bauaufsichtsbehörde könne einschreiten, wenn unbebaute Flächen von Baugrundstücken den Anforderungen des § 9 Abs. 2 der Niedersächsischen Bauordnung nicht genügten, entschied das Gericht. Denn dort ist festgelegt, "die nicht überbauten Flächen der Baugrundstücke müssen Grünflächen sein, soweit sie nicht für eine andere zulässige Nutzung erforderlich sind". Bei den Beeten der klagenden Grundstückeigentümer handele es sich nicht um Grünflächen, sondern um Kiesbeete, in die nur punktuell Grün eingepflanzt sei, so das Gericht. Das bedeutet also: um einen Schottergarten.
Kläger: Garten ökologisch wertvoll
Die Beteiligten stritten vor allem darüber, ob es sich bei den Beeten um Grünflächen im Sinne des § 9 Abs. 2 der Bauordnung handelt. Die Grundstückseigentümer machten geltend, bei den Beeten handele es sich aufgrund der Anzahl und der Höhe der eingesetzten Pflanzen um Grünflächen.
Zu klären war also die Frage, ob es sich bei dem Schottergarten um viel Grün mit ein wenig Schotter oder um Schotter mit viel Grün handelt. Ihr Garten sei unter Berücksichtigung der hinter dem Wohnhaus befindlichen Rasenflächen und Anpflanzungen insgesamt ein ökologisch wertvoller Lebensraum, argumentierten die Kläger.
Versteinerung der Stadt beschränken
Das Gericht hingegen wies darauf hin, dass Grünflächen durch naturbelassene oder angelegte, mit Pflanzen bewachsene Flächen geprägt seien. Wesentliches Merkmal einer Grünfläche sei der „grüne Charakter“. Dies schließe Steinelemente nicht aus, wenn sie nach dem Gesamtbild nur untergeordnete Bedeutung hätten. Ein solches Verständnis widerspreche der Intention des Gesetzgebers, die „Versteinerung der Stadt“ auf das notwendige Ausmaß zu beschränken, argumentierte dagegen das Gericht.
Der Fall ist insofern spannend, weil sich das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht erstmals mit der bauordnungsrechtlichen Unzulässigkeit von Schottergärten befasst hat. Der Beschluss ist unanfechtbar.
Zur Mitteilung des Gerichts