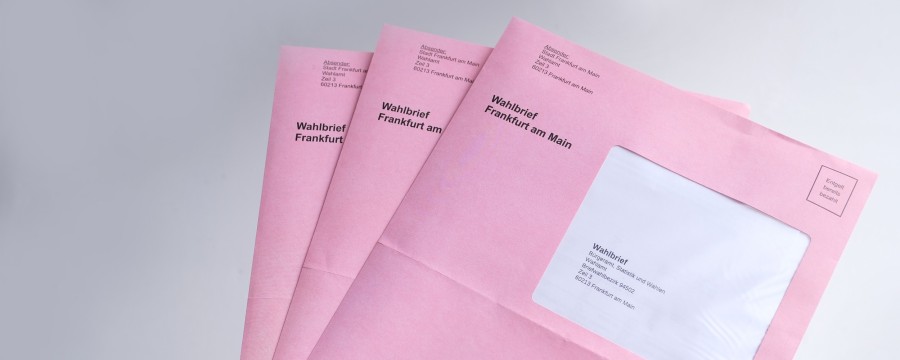Unterbringung durch die Kommunen
Wohnungslosigkeit: Kommunen stemmen die Krise
Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe meldet für 2024 mehr als eine Million wohnungslose Menschen – ein Anstieg um elf Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das Statistische Bundesamt kommt regelmäßig zu deutlich niedrigeren Zahlen - zwischen den Organisationen besteht Uneinigkeit, ob gewisse Personengruppen dazugehören oder nicht. Doch trotz anderer Berechnungsgrundlagen kommt auch das Bundesamt zum gleichen Ergebnis: Die Zahlen steigen deutlich.
Die Kommunen sind dabei die Ebene im Land, auf der die Verantwortung lastet. Sie müssen in Not geratene Menschen unterbringen, betreuen und im besten Fall den Weg zurück in regulären Wohnraum ebnen. Doch wie gelingt das in der Praxis? Acht Städte unterschiedlicher Größe gewähren Einblick in ihren Alltag – und zeigen, wie unterschiedlich die Situation vor Ort aussieht.
Kleine Kommunen bei Wohnungslosenhilfe ohne Unterstützung
In Alpirsbach, einer 6.000-Einwohner-Stadt im Schwarzwald, bringt Bürgermeisterin Vanessa Schmidt derzeit sechs Personen unter. Die Stadt hat eine eigene Notunterkunft. Auf die Frage, ob sie Betroffenen Beratung und Betreuung anbieten können, die hilft, Wohnungslosigkeit entweder zu vermeiden oder wieder in regulären Wohnraum zu kommen, antwortet Schmidt knapp: „Nein, können wir nicht.“ Es gibt keine Fachstelle für Wohnungsnotfallhilfe, keine Zusammenarbeit mit dem Landkreis, keine freien Träger vor Ort. Das Ordnungsamt ist allein zuständig.
Ein ähnliches Bild zeigt sich in Bendorf, Rheinland-Pfalz, 18.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Die Stadt hat eine Etage in der Flüchtlingsunterkunft angemietet, in der sie sieben Menschen unterbringt. Immerhin: Die Verweildauer ist mit sechs bis zwölf Monaten vergleichsweise kurz. Doch auch hier besteht keine nennenswerte Zusammenarbeit mit dem Landkreis und das Ordnungsamt ist allein in der Verantwortung. Auf die Frage nach dem größten Hindernis für den Übergang in reguläre Wohnverhältnisse antwortet Theresa Artzdorf aus der Pressestelle klar: „Adäquater freier Wohnraum“.
Das Dilemma kleiner Kommunen ist deutlich: Sie haben die gleiche Pflicht zur Unterbringung wie große Städte, aber deutlich weniger Ressourcen. In Alpirsbach belaufen sich die jährlichen Kosten auf etwa 12.500 Euro für Unterhaltung, Heizung und Versicherungen. Eine Unterstützung darüber hinaus kann die Kommune nicht finanzieren.
Interkommunale Zusammenarbeit: Gemeinsam gegen Wohnungslosigkeit
Dass interkommunale Zusammenarbeit hier helfen kann, beweist das Amt Südtondern in Schleswig-Holstein. Niebüll, eine 10.000-Einwohner-Stadt, ist Teil dieser Amtsverwaltung, die 30 Gemeinden mit zusammen 40.000 Einwohnerinnen und Einwohnern betreut. Bürgermeister Thomas Uerschels berichtet: Seit vielen Jahren ist dort das Wohnungslosenprojekt „Min Tohus" etabliert. Die 30 Gemeinden finanzieren anteilig – als freiwillige Leistung – eine Sozialarbeiterstelle beim Diakonischen Werk.
„Von dieser Stelle aus wird mit Hilfe persönlicher Ansprache und umfangreicher Netzwerkarbeit bei Behörden, Institutionen und Immobiliengesellschaften versucht die Obdachlosigkeit abzuwenden“, erklärt Uerschels.
In unserer eher kleinstädtischen und dörflichen Struktur erfahren soziale Institutionen – zum Beispiel aus Gesprächen – und Ordnungsbehörde öfter von diesem betroffenen Personenkreis, so dass gezielt eine Ansprache erfolgen kann.

Allerdings: Die Finanzierung als freiwillige Leistung macht das Projekt anfällig für Kürzungen. Und die Zahlen beunruhigen auch hier: „Tendenziell steigt die Anzahl der Personen und Familien, die von Wohnungslosigkeit bedroht sind“, berichtet Uerschels. Wohnraum sei knapp und vergleichsweise teuer, beeinflusst auch von Menschen, die von der Insel Sylt aufs Festland ziehen.
Mittelstädte zwischen Unterbringungspflicht und Ressourcenmangel
Mit wachsender Einwohnerzahl steigen die Möglichkeiten – aber auch die Herausforderungen. Henningsdorf bei Berlin, 27.000 Einwohnerinnen und Einwohner, arbeitet mit der gemeinnützigen Gesellschaft PuR, einem kommunalen Träger, zusammen, der eine Notunterkunft mit vier Plätzen betreibt. Dort gibt es nicht nur ein Dach über dem Kopf, sondern auch Unterstützung: Hilfe bei der Wohnungssuche, Begleitung zu Ämtern, Vermittlung zur Schuldnerberatung. Wohnungslose Menschen, die nicht in die Notunterkunft passen oder schon länger obdachlos sind, insbesondere bei Wohnungsknappheit, bringt die Stadt vereinzelt in Pensionen oder Hotels unter. Für alle Maßnahmen gegen Wohnungslosigkeit gab Henningsdorf im Jahr 2025 insgesamt 87.400 Euro aus.
Wohnungslosigkeit betrifft nicht nur Geflüchtete, sondern zunehmend auch Menschen aus der Mitte unserer Gesellschaft, die durch Krankheit, Arbeitslosigkeit, familiäre Krisen oder steigende Lebenshaltungskosten in Not geraten.
Die Hauptursachen für Wohnungslosigkeit sind fehlender bezahlbarer Wohnraum - auch dadurch ausgelöst, dass jedes Jahr mehr Wohnungen aus der Sozialbindung herausfallen - und Armut. Auslöser sind in den meisten Fällen Miet- oder Energieschulden, Trennung und Scheidung, notwendige Ortswechsel oder Konflikte im Wohnumfeld.
In der 37.000-Einwohner-Stadt Warendorf in Nordrhein-Westfalen hat die Kommune ein dezentrales Modell entwickelt: Sieben eigene Häuser mit Ein- und Zweizimmerwohnungen sind im Stadtgebiet verteilt – keine Konzentration auf einen Standort. Ein „Notfallzimmer" steht für akute Notlagen jederzeit bereit. Doch auch hier zeigt sich das Kernproblem: „Ein großer Teil der untergebrachten Personen bleibt dauerhaft in der Unterkunft, weil keine reguläre Wohnung gefunden wird“, berichtet die Stadtverwaltung.
Die Stadt beschreibt die Schwierigkeit so: Viele Wohnungslose hätten einen erhöhten Unterstützungsbedarf, benötigten weitreichende Hilfen bei sozialen oder psychischen Problemen und erforderten „professionelles Handeln von externen Stellen“. Für all das steht in Warendorf eine halbe Stelle einer Sozialarbeiterin zur Verfügung – für 52 untergebrachte Personen.
Kommunen organisieren Prävention von Wohnungslosigkeit
Ahrensburg in Schleswig-Holstein hat neue Unterkünfte geschaffen und Wohnungen angemietet. Außerdem investiert die 35.000-Einwohner-Stadt gezielt in Prävention. Bürgermeister Eckart Boege erklärt das System: „Bei uns bekannten Mietschuldenproblematiken bieten wir neben der Beratung auch die Kontaktaufnahme zum Vermieter an, um gegebenenfalls entsprechende Möglichkeiten zum Wohnraumerhalt auszuloten und gezielte Hilfen zu vermitteln."
Die Stadt hat eigene Haushaltsmittel in Höhe von 15.000 Euro bereitgestellt, um in Einzelfällen Darlehen zum Erhalt einer Wohnung zu gewähren.
Jeder mitgeteilte Antrag auf einen Räumungstitel oder uns bekannte Räumungstermin wird zum Anlass genommen, durch den städtischen Sozialdienst, notfalls auch durch Hausbesuch, Kontakt zum räumungsbeklagten Haushalt aufzunehmen.

Doch selbst dieses engagierte Vorgehen stößt an rechtliche Grenzen. Boege wünscht sich eine Gesetzesänderung: „Aktuell geben die Vermieter aus Datenschutzgründen keine Information über Mietschuldenproblematiken heraus. Eine gesetzliche Verpflichtung dazu wäre hilfreich, um überhaupt Hilfsangebote machen zu können."
Brühl mit umfassendem Hilfesystem für Wohnungslose
Ein sehr weitreichendes Hilfesystem unter den befragten Kommunen hat Brühl in Nordrhein-Westfalen aufgebaut. Die 46.000-Einwohner-Stadt im Kölner Umland betreut 647 untergebrachte Personen. Davon 88 ohne Fluchthintergrund und 559 mit Fluchthintergrund. 2024 waren es noch 75 Personen ohne Fluchthintergrund. Im Fachbereich Soziales gibt es eine eigene Abteilung „Obdachlose und Flüchtlinge".
Für eine Unterkunft, in der Menschen ohne Fluchthintergrund untergebracht sind, hat die Stadt den Sozialdienst Katholischer Männer beauftragt. Dessen Mitarbeiter haben ihre Büros direkt in der Unterkunft. Zusätzlich stehen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Drogenhilfe beratend zur Verfügung. In der Innenstadt sind Streetworker im Einsatz, finanziert von der Stadt. Angestellte des Jobcenters kommen aufsuchend in die Unterkunft.
Zudem ist Brühl eingebunden in den kreisweiten Arbeitskreis „Ein Zuhause für alle!", dem auch der Rhein-Erft-Kreis, weitere kreisangehörige Kommunen und das Jobcenter angehören. Das Projekt „Stark!" wendet sich aufsuchend an wohnungslose Menschen in städtischen Notunterkünften und berät bei Schulden, im Umgang mit Behörden und bei Unterkunftsangelegenheiten. Geplant ist zudem ein aufsuchendes medizinisches Hilfsangebot über den Europäischen Sozialfonds.
Die Kosten für dieses umfassende System sind erheblich: 2024 beliefen sich allein die Aufwendungen für die Unterbringung der 75 Personen ohne Fluchthintergrund und die externen Betreuungsleistungen auf rund 535.000 Euro – ohne Kosten für städtisches Personal, jedoch auch ohne Berücksichtigung der Gebühren, die von den Bewohnerinnen und Bewohnern der Unterkünfte entrichtet werden müssen.
Wohnungslosigkeit in Deutschland: Diese Menschen sind betroffen
Die Bundesstatistik zeigt: 86 Prozent der untergebrachten wohnungslosen Personen haben keine deutsche Staatsangehörigkeit, darunter viele anerkannte Geflüchtete. Dieses Bild bestätigen die meisten befragten Kommunen. Ahrensburg meldet: „Lediglich knapp neun Prozent der untergebrachten Personen haben keinen Migrationshintergrund.“ In Freiberg am Neckar liegt der Wohnungslosenanteil mit deutschem Pass ebenfalls bei unter zehn Prozent. Hier sind jeweils anerkannte Geflüchtete, die keine Wohnung finden können eingerechnet. In Brühl sind 54 von 88 Personen ohne Fluchthintergrund deutsche Staatsangehörige – das entspricht 61 Prozent dieser Gruppe, aber nur einem Bruchteil aller Untergebrachten, zählt man wohnungslose Flüchtlinge hinzu.
Bürgermeister Jan Hambach aus Freiberg am Neckar berichtet: „Der größte Teil der Wohnungslosen sind Geflüchtete. Bei den Geflüchteten finden Ukrainer leichter eine Wohnung als Flüchtlinge aus anderen Herkunftsländern.“ In Brühl kommen die meisten wohnungslosen Menschen aus Syrien, Afghanistan und der Ukraine.
Dieses Phänomen scheint jedoch eher die größeren Kommunen zu betreffen. Anders sieht es etwa in der Kleinstadt Niebüll aus: Bürgermeister Uerschels berichtet, dass vor Ort „ganz überwiegend" Personen mit deutscher Staatsbürgerschaft betroffen sind. Anerkannte Flüchtlinge oder ausländische Personen befänden sich selten im Kreis der Betroffenen. Die Unterschiede erklären sich auch darüber, dass für Flüchtlinge in vielen Fällen die Landkreise zuständig sind.
Wenn Flucht und Wohnungslosigkeit zusammenfallen
Was in den Zahlen oft untergeht: Die hohe Zahl wohnungsloser Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit ist zu einem großen Teil auf strukturelle Probleme bei der Wohnraumversorgung von Geflüchteten zurückzuführen. Die Stadt Warendorf bringt das deutlich zum Ausdruck: Von den 584 untergebrachten Personen sind 532 anerkannte Flüchtlinge in städtischen Unterkünften. Die Stadt Brühl erklärt: „Wohnungslose Geflüchtete mit gesichertem Aufenthaltsstatus verbleiben im Regelfall in den Unterkünften, die für Geflüchtete vorgesehen sind, soweit Sie keinen eigenen Wohnraum finden."
Das Problem: Nach Abschluss des Asylverfahrens und der Anerkennung als Geflüchtete müssten diese Menschen eigentlich in regulären Wohnraum vermittelt werden. Doch der ist nicht vorhanden. Die Stadtverwaltung in Brühl beschreibt die Verzahnung deutlich: „Die ‚Obdachlosenarbeit' ist somit mit der ‚Flüchtlingssituation' eng verzahnt. Ein höheres Aufkommen an Zuweisungen erhöht daher zwangsläufig auch die Daten in der Wohnungslosenberichterstattung.“ Die Vermischung zweier Herausforderungen – Fluchtmigration und Wohnraummangel – verschärft die Lage der Kommunen zusätzlich und macht deutlich: Ohne mehr bezahlbaren Wohnraum können weder anerkannte Flüchtlinge noch langjährig in Deutschland lebende Menschen aus der Wohnungslosigkeit herausgeführt werden.
Finanzierung der Wohnungslosenhilfe: Kommunen allein gelassen
Die finanzielle Belastung der Kommunen variiert erheblich. Während die kleinste befragte Kommune, Alpirsbach, mit 12.500 Euro pro Jahr auskommt – allerdings ohne Betreuungsleistungen –, gibt Henningsdorf 87.400 Euro für alle Maßnahmen gegen Wohnungslosigkeit aus. In Brühl ist es eine halbe Million.
Unterstützung von Bund oder Land? Fehlanzeige. Ausschließlich für spezielle Programme wie das Projekt „ZUHAUSE! im Rhein-Erft-Kreis" fließen Mittel aus der Landesinitiative gegen Wohnungslosigkeit. Und das, wo der Bund erst im Jahr 2024 den Nationalen Aktionsplan gegen Wohnungslosigkeit verabschiedet hat.
Der Nationale Aktionsplan gegen Wohnungslosigkeit
Der Nationale Aktionsplan ist ein ambitioniertes Papier mit dem erklärten Ziel, Wohnungs- und Obdachlosigkeit bis 2030 zu überwinden. Er fordert unter anderem menschenrechtskonforme Mindeststandards in Unterkünften, bessere Präventionsangebote und mehr bezahlbaren Wohnraum. Das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen hat zwar eine Kompetenzstelle zur Verhinderung von Wohnungs- und Obdachlosigkeit eingerichtet und fördert 74 Projekte bundesweit. Doch die Grundkosten der Unterbringung, die Finanzierung von Sozialarbeiterstellen, der Betrieb von Notunterkünften – all das tragen die Kommunen allein. Gefragt, ob sie das Ziel des Aktionsplans für realistisch halten, antwortet die Stadt Bendorf knapp: „Nein, da es an adäquatem Wohnraum mangelt.“
Bezahlbarer Wohnraum fehlt: Was Kommunen fordern
Fragt man die Kommunen, was sie bräuchten, um Wohnungslosigkeit wirksam zu bekämpfen, sind sich alle einig: bezahlbarer Wohnraum. „Die Schaffung von Sozialwohnungen ist auch in kleinen Gemeinden dringend notwendig“, sagt Bürgermeisterin Vanessa Schmidt aus Alpirsbach.
Wir benötigen ausreichende und verlässliche Fördermittel für Neubau sozialer Wohnungen beziehungsweise Sanierung bestehender Gebäude oder Ankauf von Immobilien.

Thomas Köhler aus Henningsdorf fordert eine systematische Erfassung wohnungsloser Menschen, den Ausbau von Präventions- und Beratungsangeboten, mehr dezentrale Notunterkünfte und eine bessere Koordination mit Landkreis und Sozialdiensten. „Wir brauchen daher ein gemeinsames Handeln von Kommunen, Landkreis, Land und Bund: mehr Prävention, verlässliche Daten, bezahlbaren Wohnraum und frühzeitig erreichbare soziale Unterstützung. Ziel muss es sein, Menschen nicht erst aufzufangen, wenn sie ihre Wohnung verloren haben, sondern ihnen Wege zurück zu Stabilität und Sicherheit zu eröffnen", sagt er.
Die Zahlen geben ihm Recht: Laut Statistischem Bundesamt beträgt die durchschnittliche Dauer der aktuellen Unterbringung mehr als zwei Jahre. Der Anteil der Personen, die bis zu einem Jahr untergebracht sind, liegt bei knapp 40 Prozent. Die überwiegende Mehrheit bleibt länger – manche deutlich länger.
„Das Vorhalten von Wohnungen ist aufgrund der aktuellen Wohnungsmarktlage eher illusorisch. Der Ausbau von bezahlbarem Wohnraum ist jedoch hilfreich", heißt es in Brühl. Die Stadt fordert: „Förderprogramme sollten dauerhaft installiert und ausgebaut werden. Letztendlich benötigen die Kommunen ausreichende finanzielle Mittel und personelle Kapazitäten, um Maßnahmen durchzuführen."
Wohnungslosigkeit überwinden: Was sich ändern muss
Die Einblicke in die acht Kommunen zeigen: Die Spanne zwischen dem, was sich die Städte leisten können und dem, was nötig wäre, ist enorm. Während in Alpirsbach Menschen nur ein Dach über dem Kopf erhalten, weil für weitere Betreuung keine Optionen gegeben sind, hat Brühl ein umfassendes Betreuungssystem aufgebaut. Während Ahrensburg gezielt in Prävention investiert, fehlen andernorts selbst grundlegende Beratungsangebote.
Vier Dinge werden überdeutlich:
1. Es braucht mehr bezahlbaren Wohnraum – ohne ihn bleibt jede Unterbringung eine Sackgasse.
2. Es braucht in vielen Regionen eine bessere Zusammenarbeit zwischen Städten, Gemeinden, Landkreisen und freien Trägern
3. Es braucht professionelle Betreuung und Begleitung, denn wohnungslose Menschen haben oft komplexe Problemlagen.
4. Es braucht Geld: verlässliche, dauerhafte Förderung von Bund und Ländern, nicht nur für Sonderprojekte, sondern für die Grundlagen - besonders, wenn man an dem Nationalen Aktionsplan festhalten möchte.
Solange sich daran nichts ändert, werden die Kommunen weiter versuchen, das Unmögliche möglich zu machen: Menschen ohne Wohnung eine Perspektive geben. Bei den strukturellen Problemen sind die Städte und Gemeinden jedoch nur in sehr geringem Umfang in der Lage Einfluss zu nehmen – über Wohnungsbaugesellschaften, Sozialwohnungsbau oder verschiedene Hebel, die Bodenspekulationen zu bekämpfen versuchen. Eines zeigen die Gespräche mit den acht Kommunen überdeutlich: Allein werden sie das Problem nicht lösen können.
Blick ins Ausland: Housing First
Während die meisten Kommunen auf das klassische Stufenmodell setzen – erst Notunterkunft, dann betreutes Wohnen, schließlich eigene Wohnung – verfolgt der Housing-First-Ansatz einen anderen Weg: Er dreht die klassische Wohnungslosenhilfe konsequent um: Nicht erst Therapie, Schuldenregulierung und Suchtberatung – sondern zuerst die eigene Wohnung, mietvertraglich abgesichert und ohne Vorbedingungen. Erst wenn das Dach über dem Kopf steht, setzen freiwillige Unterstützungsangebote an.
Entwickelt wurde das Modell in den 1990er-Jahren in den USA, inzwischen nutzen es zahlreiche Städte in Finnland, Dänemark, Frankreich, den Niederlanden und Österreich. Mit ersten Projekten in Berlin, Hamburg und München kommt es langsam auch in Deutschland an. Die wissenschaftliche Bilanz ist eindeutig: Internationale Studien zeigen Wohnstabilitätsquoten von 80 bis über 90 Prozent – deutlich höher als bei klassischen Stufenmodellen. Zugleich sinken Kosten für Notunterkünfte, Polizei, Krankenhäuser und Justiz. Klare Problematik auf dem Weg dorthin: Erneut der nötige Wohnraum.
Den aktuellen Bericht der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe finden Sie hier.
Den letzten Wohnungslosenbericht der Bundesregierung finden Sie hier.